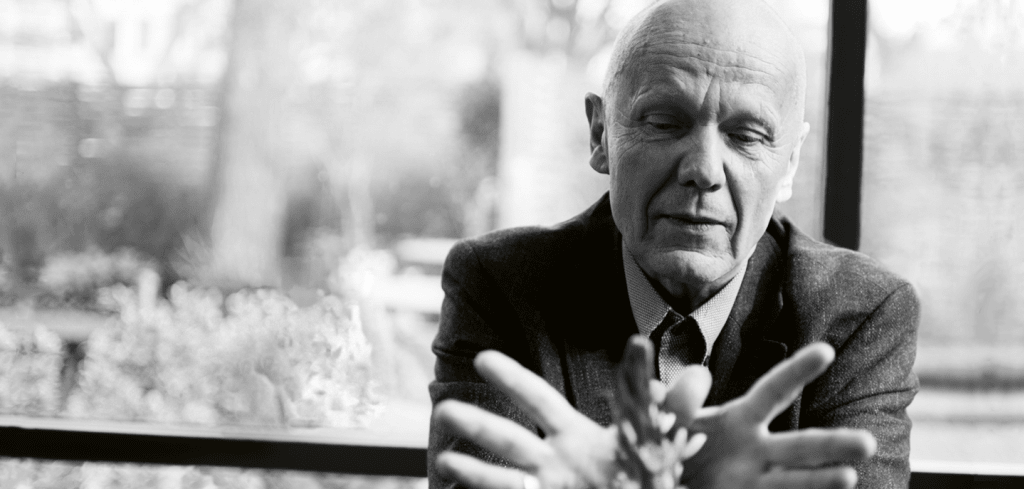«Aus einem deutschen Lied geschnitten» – das ist eine Serie von kurzen Texten, jeweils kombiniert mit einem Musikvideo. Von einer Liedzeile ausgehend, streift Georg Klein durch ganz unterschiedliche Landschaften. Es geht um den Reiz des Nichtstuns, um Film- und andere Küsse und die unheimliche Präsenz des Brillenmanns. Es geht um Erde, Feuer, Wasser und Luft, ums Tanzen – und auch um die Transparenz von Stubenfliegenflügeln.
Die musikalische Begleitung der Textminiaturen ist exquisit. «Deutsches Lied», das ist bei Georg Klein ein weites Feld: Marlene Dietrich und Rammstein, Georg Kreisler und Großstadtgeflüster, nicht zu vergessen die Elektroavantgardisten Kraftwerk (mit einer sensationellen Erstklässlerversion von «Roboter»).
Kurz: Georg Klein macht Text und «Musik / Da bleibt dir die Luft weg» (Ilse Werner).
Ein wunderlicher Ratschlag! Zumindest ein Rat, der sich, hört man ihn gesungen oder gesprochen, nicht von selbst versteht. Wenn ich, semantisch-pedantisch, die verwendeten Verben ins Auge fasse, scheint es auf eine hintersinnig zwiefache Weise um Besitz zu gehen: Angst haben und/oder einen Swimming-Pool sein Eigen nennen. Wobei die Angst vor der Zukunft zweifellos zu den unerwünschten Besitztümern zählt, jedoch durch den monetären Erwerb des anderen Eigentums aufgehoben werden kann. Ungefähr so, wie man mit einer gewissen Berechtigung sagen kann: «Wenn du Mäuse hast, hol’ dir eine Katze! Der Kauf des Zweiten wird dich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vom Ersten erlösen.»
Bis jetzt haben ich und diejenigen, mit denen ich zusammenlebte, nie einen Swimmingpool besessen. Und ich muss weit, bis in meine erste Zeit am Gymnasium, zurückgehen, um unter denen, die mir eine Zeitlang nahekamen, einen – den Einzigen! – ausfindig zu machen, der ein derartiges Privatschwimmbecken nutzen konnte. Die Eltern eines Klassenkameraden hatten sich ein nicht bloß ungewöhnlich stattliches Eigenheim gebaut, sondern einen großen Teil des Grundstücks dafür verwendet, einen negativen Quader in die Erde senken zu lassen. Als ich eines Samstagnachmittags mit meinem Schulfreund erstmals am Rand des Pools stand, rechnete ich noch damit, gleich in diesem amerikanisch-filmisch lichtdurchfluteten Wasser planschen zu können. Aber von dessen Oberfläche her wurde ich eines Besseren belehrt.
Auf einer Luftmatratze trieb der Vater meines Freundes und teilte uns mit, sicherheitshalber müsse er uns das Baden im Pool verbieten. Er habe es nämlich versäumt, während der Woche konsequent nachzuchloren. Eventuell hätten sich gefährliche Bakterien gebildet. Das Risiko sei ihm bei Kindern, noch dazu bei einem Buben, der nicht zur Familie gehöre, einfach zu hoch.
Rückblickend kann ich nicht mehr sagen, inwieweit ich seine Sorge verstand und ob ich mir seine Bedenken brav zu eigen machte. Vielleicht lenkte mich der Anblick des Poolbesitzers zu sehr ab. Denn dieser war, darauf hatte mich mein Schulfreund nicht vorbereitet, auf eine besondere Weise unvollständig: Bis auf einen kurzen Knubbel fehlte ihm der rechte Arm. Anderenorts, zum Beispiel am Rand eines öffentlichen Schwimmbeckens, hätte mich dies damals, gut zwei Jahrzehnte nach dem letzten Weltkrieg, wenig überrascht. Aber hier, in diesem türkis glitzernden Rechteck, schien mir ein Mann fast zwingend zum Besitz beider Arme verpflichtet. Mit dem verbliebenen linken stach er in das sachte Gekräusel und lenkte seine Luftmatratze geschickt in die Mitte des Pools. Dessen unzureichend gechlortes Wasser sah er offenbar nicht als eine Gefahr für sich selbst an. Zumindest was den eigenen Leib anging, hatten ihn die in der Vergangenheit durchlittenen Ängste gegen Sorgen kleineren und größeren Kalibers gefeit. Er war schlicht hinreichend versehrt. Aber diese Immunisierung schloss seinen Sohn und mich nicht ein. Unser weiteres Befinden, also die Zukunft derjenigen, in deren Körpern noch schaurig viel kommende Zeit schwappte, war ihm Anlass zu furchtsam vorausäugender Achtsamkeit.
Viel mehr lässt sich eventuell gar nicht erreichen. Jahr um Jahr, Jahrzehnt auf Jahrzehnt, schwimmen wir im Pool der Angst. Selten steht einem das wirkliche Wasser, ab und an allerdings ein imaginäres Nass bis zum Hals. Irgendwann jedoch, sobald das Becken endlich randvoll mit abgetaner Zukunft ist, dürfen wir noch ein knappes, langes Weilchen, zumindest ohne Sorge um uns selbst, auf der türkisen Oberfläche unseres Daseins planschen.
Für Rat aller Art danke ich Stephan Turowski und Wilko de Vries.