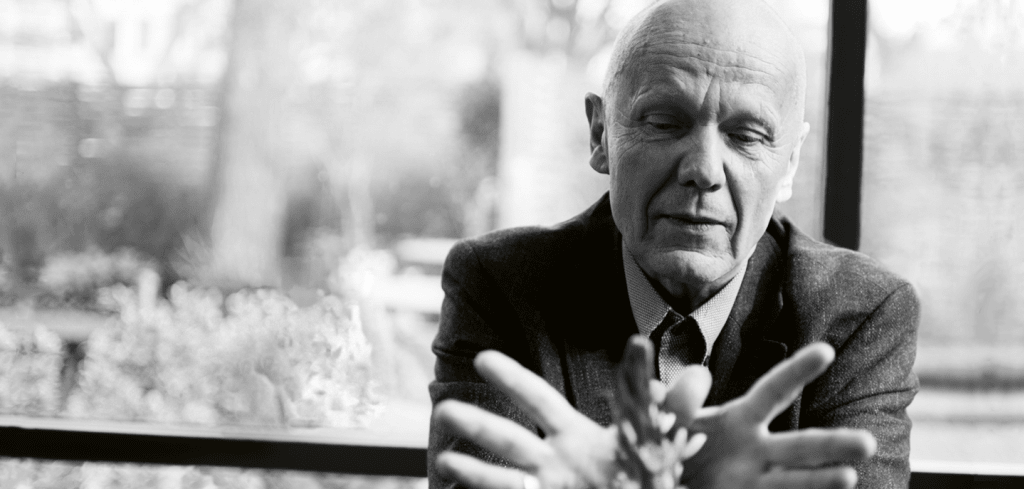«Aus einem deutschen Lied geschnitten» – das ist eine Serie von kurzen Texten, jeweils kombiniert mit einem Musikvideo. Von einer Liedzeile ausgehend, streift Georg Klein durch ganz unterschiedliche Landschaften. Es geht um den Reiz des Nichtstuns, um Film- und andere Küsse und die unheimliche Präsenz des Brillenmanns. Es geht um Erde, Feuer, Wasser und Luft, ums Tanzen – und auch um die Transparenz von Stubenfliegenflügeln.
Die musikalische Begleitung der Textminiaturen ist exquisit. «Deutsches Lied», das ist bei Georg Klein ein weites Feld: Marlene Dietrich und Rammstein, Georg Kreisler und Großstadtgeflüster, nicht zu vergessen die Elektroavantgardisten Kraftwerk (mit einer sensationellen Erstklässlerversion von «Roboter»).
Kurz: Georg Klein macht Text und «Musik / Da bleibt dir die Luft weg» (Ilse Werner).
Von den vier Elementen, aus denen alles in unserer Welt bekanntlich zusammengesetzt ist, verstehen sich drei, die Erde, das Wasser und das Feuer, wie von selbst. Der graue Stein wiegt schwer, bevor wir ihn fallen lassen und auf dem Grund aufschlagen hören. Die Wärme und der Geruch des brennenden Holzes strömen uns, umfangen von Licht, entgegen. Das Wasser bricht die Strahlen der Sonne, und obwohl die Fingerspitzen sein kühles Fließen nicht festzuhalten vermögen, lässt es sich doch mit der hohlen Hand an die Lippen schöpfen und schmeckt in unserem Mund nur beinahe nach nichts.
Allein das vierte Element spendet unseren Sinnen keine gleichermaßen verlässliche Erfahrung. Unsere Haut spürt seine Anwesenheit allenfalls, wenn es in heftige Bewegung gerät oder wenn seine Temperatur jäh wechselt. Es scheint kein Gewicht zu besitzen, obschon es sich doch bis an das Kristall der Himmelsschale erstreckt und folglich mehr als berghoch auf unseren Schultern lastet. Die Gerüche, die es uns zuträgt, sind dem Erdhaften oder dem Feurigen geschuldet, und seine Unsichtbarkeit wird allenfalls mittelbar aufgehoben, sobald es Rauch oder Staub mit sich führt oder wenn es als Wind die Wipfel der Bäume schüttelt.
So versteht die Luft als viertes Element, unser Wahrnehmen zu narren, und das Gehör ist derjenige Sinn, der hierauf mit einem Überschuss an Einbildung reagiert: Die bewegte Luft scheint etwas zu flüstern, ja für uns zu singen. Und den Poeten gefällt es zu behaupten, das ominöse Säuseln habe etwas ganz Bestimmtes zu berichten. Selbst von einem Glück so überwältigend groß, dass unserem Sprechen die angemessenen Worte fehlten, könne niemand anders als ausgerechnet der Wind in einem seiner Lieder erzählen.
Wenn ich der Archäologie Glauben schenken darf, dann sind die ältesten Musikinstrumente unserer Gattung dem Tod geschuldet. In die Knochen von Mammut und Gänsegeier, also von Beutetieren und von Aas, wurden Löcher gebohrt. Und falls wir uns heute nicht völlig in diesen Artefakten irren, haben unsere Urahnen das bearbeitete Gebein an die Lippen gesetzt, um pustend verschieden hohe Töne zu erzeugen.
Voreilig wäre es jedoch, von einem Musizieren in unserem viel späteren Sinne zu sprechen. Wir wissen nicht, wofür die Menschen den Klang dieser knöchernen Utensilien gebrauchten. Womöglich war deren Tönen gegen das Heulen des bitterkalten Windes gerichtet, der ihre Horde tief in eine Felsenhöhle getrieben hatte und dessen Stöße sogar dort noch das wärmende Feuer zum Flackern brachten. Immer ahmte der Mensch nach, was ihm in seiner Schrecklichkeit unbesiegbar schien. Ähnliches sollte Ähnliches bannen. Und der kleine Wind unseres Atems war, gegen eine Knochenkante geblasen, vielleicht in der Lage, das chaotisch brüllende Stürmen der Lüfte durch ein maßvoll geregeltes Auf und Ab, durch eine melodische Ordnung, zu bannen.
So könnte es dereinst gewesen sein. Rätselhaft groß aber bleibt der Sprung hin zu der Vorstellung, der Wind träte uns seinerseits mit einem Lied, also nicht nur mit einer Melodie, sondern dazu mit verständlichen Worten entgegen. Nordamerika gilt als der Kontinent der Stürme. Der Tornado und der Hurrikan sind diesseits und jenseits der Rocky Mountains zu ihren weltweit geläufigen Namen gekommen. Just dort hat auch die Mär vom Wind als Liedermacher viele Anhänger unter denen, die selber dichten und singen. Und folglich wird ihr dort auch auf eine besonders entschiedene Weise widersprochen. Denn unter den vielen amerikanischen Songs, durch deren Text die Lüfte wehen, gibt es einen, der in seinem Refrain von einem Idiotenwind spricht, also von einer Macht, die sich jedem sinnigen Erzählen auf eine fürchterlich blöde, unbezweifelbar elementare Weise entzieht.
Für Rat aller Art danke ich Stephan Turowski und Wilko de Vries.