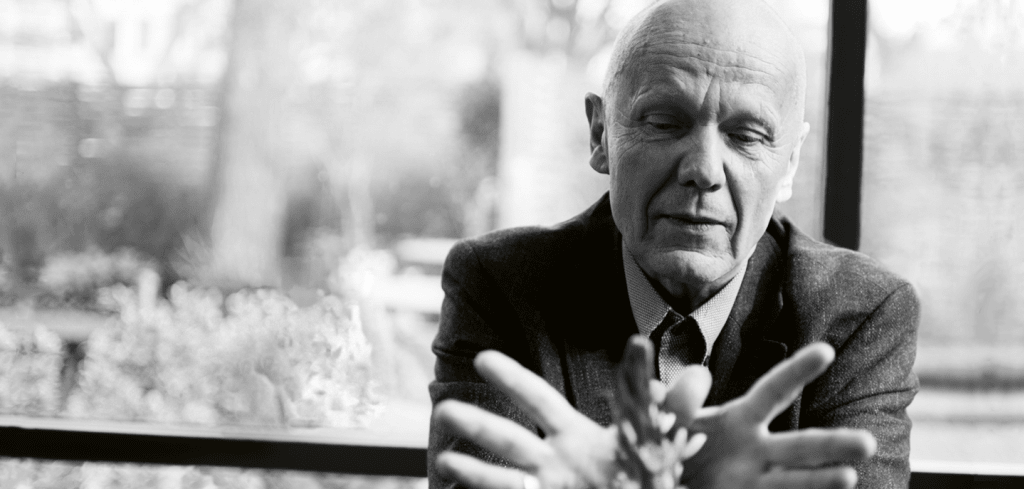«Aus einem deutschen Lied geschnitten» – das ist eine Serie von kurzen Texten, jeweils kombiniert mit einem Musikvideo. Von einer Liedzeile ausgehend, streift Georg Klein durch ganz unterschiedliche Landschaften. Es geht um den Reiz des Nichtstuns, um Film- und andere Küsse und die unheimliche Präsenz des Brillenmanns. Es geht um Erde, Feuer, Wasser und Luft, ums Tanzen – und auch um die Transparenz von Stubenfliegenflügeln.
Die musikalische Begleitung der Textminiaturen ist exquisit. «Deutsches Lied», das ist bei Georg Klein ein weites Feld: Marlene Dietrich und Rammstein, Georg Kreisler und Großstadtgeflüster, nicht zu vergessen die Elektroavantgardisten Kraftwerk (mit einer sensationellen Erstklässlerversion von «Roboter»).
Kurz: Georg Klein macht Text und «Musik / Da bleibt dir die Luft weg» (Ilse Werner).
Die denkbar dünnste Hülle, transparenter als ein Stubenfliegenflügel und dehnbarer als der Latexhandschuh eines Neurochirurgen, umschließt das Gebilde, welches wir in Ermangelung eines besseren Begriffs unser Bewusstsein nennen. Es ist jene Instanz, die uns «Hier drinnen natürlich!» antworten müsste, wenn wir sie fragten, wo sie ihren Aufenthalt hat. Aber selbst unter Einwirkung starker halluzinogener Drogen hat sich mein Bewusstsein nie zum Ort seines Verweilens geäußert. Seine Innwändigkeit versteht sich auf eine Weise von selbst, die über ein «im Körper» oder ein «im Gehirn» hinausgeht. Denn auf eigentümliche Weise ist es rundum mit einem «Außen» verwachsen. Und allenfalls fragmentarisch offenbart sich, wie unsere Bewusstheit die von dort anbrandenden Informationen filtert, regelt, ordnet und deutet.
Auch den Tieren, selbst den angeblich primitiven, gestehen wir prinzipiell Derartiges zu. Dass die Mücke auffliegt, wenn unser Schatten auf sie fällt, und die Spitze des Regenwurms zurückzuckt, sobald wir sie antupfen, genügt uns, um an ein einfaches Selbstbewusstsein zu glauben. Offenbar sind auch diese kleinen Kreaturen mit Hilfe ihrer Sinnesapparatur in der Lage, zwischen einem Außen und einem Innen ihrerselbst zu unterscheiden.
Ja, sogar die Pflanzen scheinen eine solche Differenz zu ziehen. Wie wäre es sonst möglich, dass die Sonnenblume ihr schweres Haupt ins Licht dreht und der Mimosenstrauch seine gefiederten Blätter einklappt, sobald ein heftiger Luftzug deren Oberfläche reizt. Die moderne Naturwissenschaft, zu deren Stärken der mikroskopisch in die Tiefe dringende Blick gehört, hat die Schamhaftigkeit der Mimose bis in die einzelne Zelle hinab verfolgt, um noch an deren Wandung einen osmotischen Druckwechsel zwischen einem Innen und Außen dingfest zu machen.
Die Außenwelt, das muss für unsere Spezies ungezählte Jahrtausende hindurch die mirakulöse Fülle der unkontrollierten Natur gewesen sein. Aus dem, was sie tagtäglich an Gefahr und an Sinneslust versprach, aus dem gefletschten Gebiss des Säbelzahntigers, aber auch aus der überwältigenden Süße des Honigs, den schon unsere Urahnen den Bienen raubten, setzte sich eine Wirklichkeit zusammen, von der die Blase des Bewusstseins wie von einer unendlich weiten, mehr oder minder opaken Muskulatur umschlossen wurde.
So lässt sich zumindest in einer Art Rückschau spekulieren. Für uns Hochzivilisierte scheint ein derart wildes Außen gerade noch vorstellbar. Und in unseren romantischen Stunden neigen wir dazu, diesem urigen Umfangensein eine besondere Heimeligkeit, eine primäre Geborgenheit zuzusprechen, die auch den täglichen Kampf und die grausame Kürze des damaligen Daseins zu hehrer Natürlichkeit verklärt.
Aber seit es diese Natur nicht mehr gibt, seit die Tiere und Pflanzen sich in unsere Sklaven, beziehungsweise in unsere Sorgenkinder verwandelt haben, sind wir aus der Wirklichkeit in die Realität gestürzt. Unser heutiges Bemühen, diese zu verstehen, orientierte sich zunehmend am Aufbau unserer Maschinen. Mittlerweile könnten deren irrwitzig komplex gewordene Abläufe dem nahekommen, was sich, selbstklar und dennoch unerklärt, hinter dem Seelenhäutchen unseres Bewusstseins abspielt.
Ach, apropos Maschinen und Natur: In den radioaktiv hochverseuchten Reaktorblock Vier des havarierten Atomkraftwerks von Tschernobyl dringen ab und an Roboter vor, um nach dem Rechten zu sehen. Dort, in einem wirklich speziellen Innen, haben die emsigen Messmaschinen auf den Wänden Pilze entdeckt, deren Gedeihen Rätsel aufgibt. Die noch immer mörderisch harte Strahlung des einstigen Unglücks scheint den Stoffwechsel dieser Wesen, die weder Tier noch Pflanze sind, heftig zu stimulieren. Es wächst und wächst, dass es eine Pracht ist. Und womöglich lohnt es sich, draußen bei uns, im hermetisch allgegenwärtigen Realitätärätää der Smartphones, mit Muße über das stille Selbstgespräch der Bewusstheit zu spekulieren, das jene Gewächse verbergen?
Für Rat aller Art danke ich Stephan Turowski und Wilko de Vries.