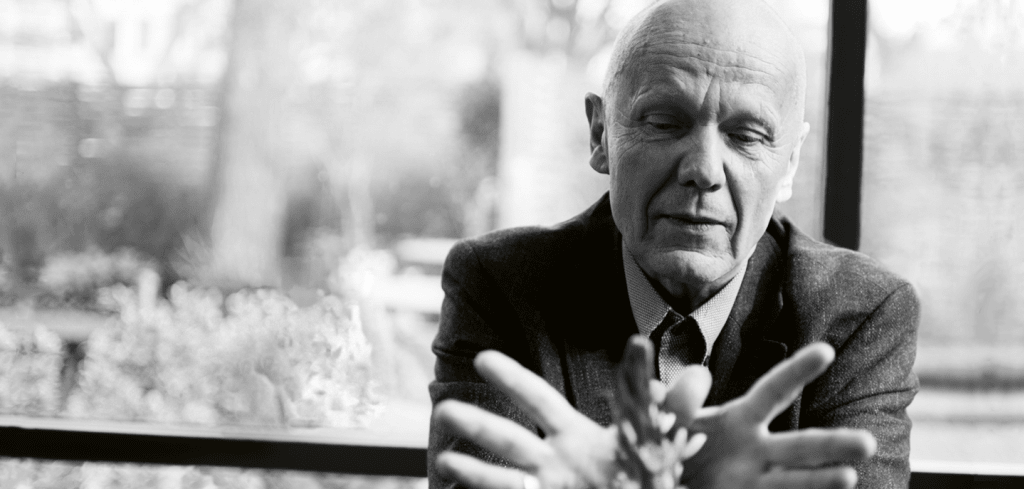«Aus einem deutschen Lied geschnitten» – das ist eine Serie von kurzen Texten, jeweils kombiniert mit einem Musikvideo. Von einer Liedzeile ausgehend, streift Georg Klein durch ganz unterschiedliche Landschaften. Es geht um den Reiz des Nichtstuns, um Film- und andere Küsse und die unheimliche Präsenz des Brillenmanns. Es geht um Erde, Feuer, Wasser und Luft, ums Tanzen – und auch um die Transparenz von Stubenfliegenflügeln.
Die musikalische Begleitung der Textminiaturen ist exquisit. «Deutsches Lied», das ist bei Georg Klein ein weites Feld: Marlene Dietrich und Rammstein, Georg Kreisler und Großstadtgeflüster, nicht zu vergessen die Elektroavantgardisten Kraftwerk (mit einer sensationellen Erstklässlerversion von «Roboter»).
Kurz: Georg Klein macht Text und «Musik / Da bleibt dir die Luft weg» (Ilse Werner).
Das Ding spricht. Aber bis auf den heutigen Tag halten es die meisten von uns bloß für einen hübschen technischen Schnickschnack, sobald uns eine Maschine mit gesprochenem Wort zu Diensten ist. Wir wissen: Was da aus dem Navigiationsgerät unseres Autos tönt, ist irgendwann anderenorts von einer Frau aus Fleisch und Blut aufgesagt und in eine nach Belieben reproduzierbare Audiodatei verwandelt worden. Und obwohl jeder Satz bestechend präzis auf die Bewegung unseres Körpers durch Raum und Zeit verweist, fühlen wir uns keineswegs mit einem wirklichen Du, also mit einem Ich unseres Kalibers, verbunden.
Ähnlich wie unser Ohr wahrt auch unser Auge skeptische Distanz. Wenig überzeugend erscheint unsereinem, was auf einschlägigen Messen als Pflegeroboter präsentiert oder im Internetversandhandel als Real Doll aus Silikon angepriesen wird. Und sogar, wenn wir eine Art Gegenprobe machen und nach den Bildwerken fragen, die das noch nicht Existierende, das Begehrte oder Befürchtete, zumindest überzeugend vortäuschen, siegt der Mensch. Im Film, der illusorisch aus dem Vollen schöpfen kann, bleibt der leibhaftige, allenfalls glasiert geschminkte Schauspieler weiterhin der beste Darsteller jener komplexen Künstlichkeit, die unserem naturhaften Erscheinen eines futuristischen Tages maximal nahekommen soll. Trügerisch getreu sollen diese zukünftigen Gebilde dann sein und ihr Verhalten bis ins Detail auf das unsere zugeschnitten.
Zumindest sieht unser Erwachsenenverlangen dies so. Als Kinder jedoch fanden wir Gefallen an allen humanoiden Robotern, die uns in die Hände fielen. Die Begrenztheit der jeweiligen maschinellen Möglichkeiten störte uns kein bisschen. Das erste derartige Ding, dem ich begegnete, war eine Puppe, die eine meiner Cousinen geschenkt bekommen hatte. Auf dem Rücken des Spielzeugs befand sich eine gelochte Blechscheibe, darunter ein Nylonfaden mit weißem Plastikring. Und wenn man an diesem gezogen hatte, sagte die Puppe einen der ihr möglichen Sätze auf. Dieselbe Robotermaid konnte, falls man sie auf ebenen Untergrund stellte, steifbeinig losmarschieren, und dass sie nach spätestens drei Schritten unweigerlich auf ihr Stupsnäschen stürzte, deutete ihre Besitzerin nicht als einen Mangel, sondern als ein stets aufs Neue anrührendes Missgeschick, das umgehend mit einem einfühlsamen «Hast du dir wehgetan?» quittiert werden konnte.
«Funktionspuppen» heißen im Fachhandel Spielzeuge, die einen menschlichen Körper, meist einen Säugling oder ein Kleinkind im Krabbelalter, nachbilden und wenige isolierte Elemente seines Weltverhaltens simulieren. Gerade in der klaren Beschränkung liegt der Zauber dieser Robotik. Zu den unweigerlich bewegenden Höhepunkten des Science-Fiction-Films gehören daher die Szenen, in denen ein Roboter, der dem Zuschauer ans Herz gewachsen ist, schwer beschädigt wird und stirbt. Zuletzt braucht es bloß noch zwei Funktionen, um seinen Abschied von uns, seinen elend komplizierten Vorbildern, recht schmerzlich in die Länge zu ziehen: eine Stimme, die in letzten ruckelig stockenden Sequenzen verendet, und dazu ein einziges Moment der anatomischen Mechanik, zum Beispiel eine nur noch ab und an unkontrolliert zuckende Hand.
Funktion scheint ein eisig kaltes Wort. Aber immerhin verweist seine erste Silbe auf jenen Funken, der die tote Materie wie mit einem magischen Fingerschnipsen in jenes Reich überführt, dem unsere Körper mit dem ersten Pulsieren der befruchteten Eizelle angehören. Noch können wir diesen Übergang den Mineralien, den Metallen und unseren komplexen Kunststoffen nicht aufzwingen. Aber gerade in den simpelsten Robotern ist unser technologisches Verlangen, das Feuer des Lebens in den Dingen zu zünden, auf eine rührend gruselige, auf eine wehmütig sehnsüchtige Weise bereits gültig Gestalt geworden.
Für Rat aller Art danke ich Stephan Turowski und Wilko de Vries.