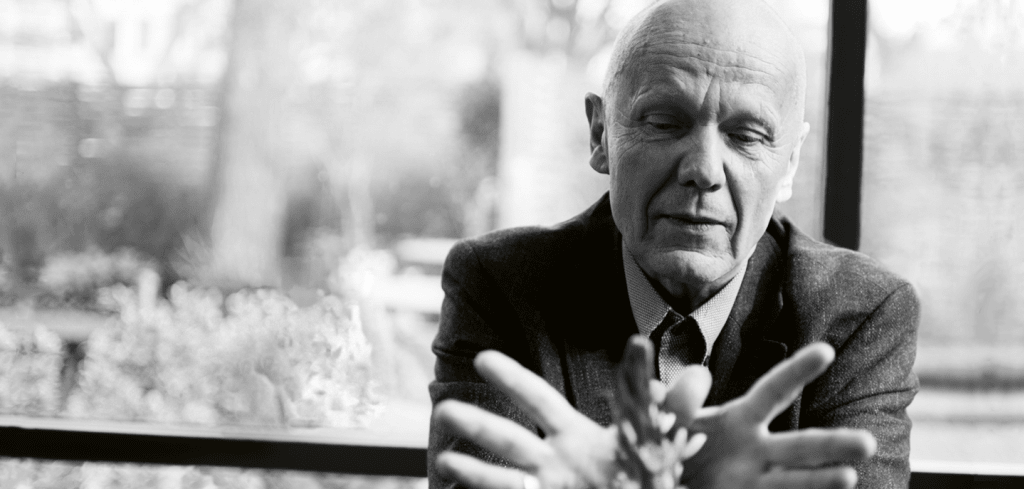«Aus einem deutschen Lied geschnitten» – das ist eine Serie von kurzen Texten, jeweils kombiniert mit einem Musikvideo. Von einer Liedzeile ausgehend, streift Georg Klein durch ganz unterschiedliche Landschaften. Es geht um den Reiz des Nichtstuns, um Film- und andere Küsse und die unheimliche Präsenz des Brillenmanns. Es geht um Erde, Feuer, Wasser und Luft, ums Tanzen – und auch um die Transparenz von Stubenfliegenflügeln.
Die musikalische Begleitung der Textminiaturen ist exquisit. «Deutsches Lied», das ist bei Georg Klein ein weites Feld: Marlene Dietrich und Rammstein, Georg Kreisler und Großstadtgeflüster, nicht zu vergessen die Elektroavantgardisten Kraftwerk (mit einer sensationellen Erstklässlerversion von «Roboter»).
Kurz: Georg Klein macht Text und «Musik / Da bleibt dir die Luft weg» (Ilse Werner).
Ein halbes Leben ist es mittlerweile her, dass ich das erste Spiel der fraglichen Art kennenlernte. Vor mir und einem Freund stand ein Kästchen, mit dessen elektronischem Zutun wir ein virtuelles Tischtennismatch bestreiten konnten. Die schlichte Konsole verfügte über zwei Drehknöpfe und war mit einem Röhrenfernseher verkabelt. Den Bildschirm teilte das zum Strich stilisierte Netz, der hin und her schwebende Ballfleck konnte mit einem vertikal verschiebbaren Bälkchen, dem Repräsentanten des Spielers, ins jeweils andere Feld zurückgeprellt werden.
Was meine Fingerspitzen bewerkstelligten, was meine Augen als TV-Bild wahrnahmen, verlief trügerisch gleichzeitig. Die Hand fütterte die Konsole mit Bewegung, und mein Bildschirm-Alter-Ego schien prompt zu gehorchen. Unwillkürlich bildete ich mir ein, zu tun, was da im Glas geschah. Im Bann der steten Anschauung und im engen Takt der minimalistischen, aber obligatorischen Handarbeit verschränkte sich mein äußeres Ich mit dem, was mir das Spiel als virtuellen Akteur anbot.
Ihm wie mir schien gemeinsam zunehmend mehr zu gelingen, aber auch die Fehlschläge fesselten uns aneinander. Diese Form der Verdopplung und Verkopplung, dieses merkwürdig innige Zwei-Sein gefiel mir, aber die Armut der Handlungsmöglichkeiten und die Monotonie des bildlichen Geschehens begannen mich irgendwann zu langweilen. Ich war technisch zu unerfahren, technologisch zu naiv, vielleicht auch zu jugendlich denkfaul, um zu bemerken, dass da, vor dem Röhrenfernseher, die Finger auf einem plumpen Drehknopf, ein neuartiges Spielen seinen Anfang genommen hatte.
So weit die Frühzeit. Der Satz «Nö, ich zock lieber!» markiert weltweite Gegenwart. Der Fortschritt der Rechnertechnologie macht mittlerweile Games möglich, die in der visuellen Gestaltung ihrer Handlungswelten fast jeden Hollywoodfilm in den Schatten stellen und in puncto Figuren- und Handlungsreichtum fetten Romanen das Wasser reichen.
Mit derartigen Vergleichen wird sich allerdings eher der Nicht- oder Gelegenheitsspieler abgeben. Der hartgesottene Zocker braucht keine Legitimation, die sein Tun an konkurrierenden Künsten misst. Sein schnödes «Nö!» erteilt nicht bloß dem Romanschmökern oder Block-Buster-Glotzen eine Absage. Ebenso gering geschätzt wird alles, was zu den scheinbar selbstverständlichen, fraglos legitimierten Topspielen unserer Gesellschaft zählt: die Karriere wie der gehobene Konsum, die Vermögensbildung wie das Familiengründen, die Selbstoptimierung genauso wie der perfekte Sex.
Es fällt leicht, in einem solchen Fall von Sucht zu sprechen. Aber unter dem Deckmantel dieses ächtenden Begriffs verschwindet, dass es nie zuvor eine vergleichbar grandiose Verschränkung von Hand und Auge, von Bild und manueller Bildmanipulation gegeben hat. Wer diese Spiele spielt, weiß durchaus, dass er nicht der Schöpfer der Welt ist, die er virtuell erlebt. Aber der Raum, die Zeit und die Handlungsmöglichkeiten, die ihm Rechner und Programm aufspannen, lassen ihn zum Wirkgott der gebotenen Bildfolgen werden. Als dieser kleine Zockgott kann er eine Fülle von sichtbar Machbarem bewerkstelligen, so er seinen Teil an flinker Fingerarbeit, an Konzentration, an Lernbereitschaft und Durchhaltevermögen aufbringt. Dann hält auch das Spiel, was es verspricht.
Wäre ich heute jung, hätte mich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Zocken am Schopf. Stattdessen bin ich in das chronische Verfertigen von Literatur geraten. Einbilden darf ich mir hierauf nichts. Denn dass ich die Schnittstellen, die mir die Spielmaschinen boten, unberührt ließ, war bloß der Gunst oder Ungunst der frühen Geburt, der Dürftigkeit jenes ersten Spiels und später dann dem Ungeschick meiner Finger und der Lahmheit meiner Reflexe geschuldet.
Für Rat aller Art danke ich Stephan Turowski und Wilko de Vries.