«Ich möchte mich nicht mehr wehren müssen»
«Blühen möchte ich im Eis der Gegenwart. Stürzen in jede Höhe …»: Martin Walsers «Spätdienst»

«Das Alter ist ein Zwergenstaat, regiert von jungen Riesen.» Wer sagt das? Ein lyrisches Ich zwischen Glücksmomenten und Schwärze, Leere, Sturz. Beim Durchkämmen des Hundefells, beim Aufschneiden eines Apfels oder immer dann, wenn die Berge im Blau stehen, der Wind in den Bäumen rauscht, die Blätterschönheit den Atem raubt, kommt sie auf – die Frage, ob das das Glück sei. Denn lange währt es nie. Schon fährt etwas dazwischen, Wörter, die wehtun, ausgesprochen von anderen, gegen die nur eines hilft: «Sich in Verse hüllen, als wären es Schutzgewänder, schön, weltabweisend, die Einbildung heißt Aufenthalt …» Martin Walsers Lebensstenogramme – «Destillate des Denkens, die auch von Georg Christoph Lichtenberg oder Karl Kraus stammen könnten» (MDR Kultur).
Die Zeit: «Ein schönes und bewegendes Buch (...). Da ist er wieder, der betörende Walser-Klang (...). Walser ist ein himmelhoch jauchzender und zu Tode betrübter Übertreibungskünstler, dessen Vitalität bewundernswert bleibt.»
Luzerner Zeitung: «In ‹Spätdienst› entlockt Martin Walser seinen literarischen Miniaturen Melancholie und poetische Kraft.»
Stuttgarter Zeitung: « Das gehört eben auch zu diesem Autor, wenn er ‹aus Erfahrungen Gedanken macht›: dass er alles, was daran schmerzhaft ist, der Sprache und ihrer verwandelnden Wirkung anheimgibt. Sie ist es, die bleibt.»
Kölnische Rundschau: «Vergänglichkeit in Versen feiern (…). Viele dieser gesammelten Stenogramme haben die Unmittelbarkeit und Intimität von Tagebuchnotizen, wobei der Autor weiterhin einer einsamen Sprachschönheit huldigt.»
Märkische Allgemeine: «Schöner kann man vom Loslassen kaum schreiben.»
Badisches Tagblatt: «Martin Walsers Lebensbilanz ist eine todtraurige Lektüre.»
Nürnberger Zeitung: «Mit ‹Spätdienst› hat sich Walser selbst ein Requiem komponiert. Er kostet die Süße der Todesidee, wie etwas, woran er nicht glaubt.»
Vom «Unglücksglück» eines langen Lebens
Auf gut 200 Seiten enthält «Spätdienst» Hunderte kurzer und kürzester Texte. Naturlyrisches neben Politischem, Reflexionen über Leben und Tod, Friedliches und Provozierendes, Abrechnungen mit «Feinden» im Feuilleton (von Reich-Ranicki und Karasek über Raddatz und Schirrmacher bis Löffler und Höbel): Gedanken, Gedichte, Aphorismen, Notate, begleitet von zarten Arabesken seiner Tochter Alissa. In seiner «formlosen Form» ist «Spätdienst» am ehesten vergleichbar mit Walsers «Meßmer»-Trilogie.
Von Altersmilde kann keine Rede sein, nie. Es scheint, als wachse die Dünnhäutigkeit gegenüber verletzender Kritik im Alter noch. «Ist es nicht seltsam?», fragt Ulrich Greiner in der Zeit. «Der berühmteste lebende deutsche Schriftsteller, Autor von 50 oder 60 Romanen, Träger fast aller bedeutender Preise (mit Ausnahme des Nobelpreises), dieser Mann, der seit den Ehen in Philippsburg (1957) an vorderster literarischer Front steht, regt sich über Kritiken auf, die mitsamt ihren Urhebern zum Teil längst vergessen sind?»
Im März 2019 wird Martin Walser 92 Jahre alt. Dass man jedes neue Walser-Buch seit Jahrzehnten schon als Alterswerk bezeichnet, ist schon kurios; er selbst hat diese Verortung mit dem Wort «Altersalterswerk» karikiert. Walser hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er bis zum Tod weiterschreiben werde. Schreiben ist für ihn Lebensart, Lebensmittel – unverzichtbar. Einer mit diesem Arbeitsethos geht zum Spätdienst, zur Nachtschicht. Mit Schwermut, aber ungebrochen. Die Gebrechen des Alters, das Wenigerwerden, die Einsamkeit angesichts des immer näher kommenden Todes lassen sich nicht ignorieren, erst recht nicht weglächeln. Das Sterben hat jetzt angefangen – das sagen Sätze wie «Es tanzen die Blätter im Wind, / wissen nicht, dass sie am Fallen sind». Oder: «Es ist still. Ich will nicht wissen, / was die Stille will. Der Schnee deckt zu, / was ich nicht wissen will. / Ich kann die Augen schließen, / die weiße Last liegt auf der schwarzen.»
Hier eine kleine Auswahl von Kürzesttexten aus «Spätdienst»:
«Die Sehnsucht ist ein langsamer Tiger, genüsslich wirst du zerrissen …»
Ich bin kalt, ich bin warm,
ich bin reich, ich bin arm,
ich bin wie du und bin wie ich,
wer bin ich, frage ich dich.
Die Ohren schutzlos in der Welt,
barfuß im Traumsamt, verwöhnt
von Religion und Märchen,
leugne ich täglich den Tod.
Ich liebe den Leerlauf des Winds
durch die Bäume, das Rauschen
für nichts. Mich ergreift die Eitelkeit
der Wolken, die den Augenblick
beherrschen wie für immer
und dabei schon vergehen.
Sag etwas Glückliches, zähle auf,
dass dir nichts weh tut,
du nicht frierst, nicht hungrig bist,
dass die Konten blühen, dass du
frei bist, zu tun und zu lassen,
und dass das alles ein jähes Ende haben wird.
Eine Lücke möchte ich sein im Zaun
der Welt. Hereinströmen sollte durch mich
das, was nicht hineindarf. Blühen möchte ich
im Eis der Gegenwart. Stürzen in jede Höhe.
Lösch das Licht in dir
mach der Schwärze Platz,
den Wörtern kündige,
sie haben nichts genützt.
Am besten ist es, durch fremde Städte zu gehen,
Bekannte, die man hat, nicht anzurufen,
die Karten fürs Theater zu kaufen,
die Vorstellung zu versäumen,
die Süße der Todesidee zu kosten
wie etwas, woran man nicht glaubt.
Die Straßenbahnen fahren auf mich zu,
angefüllt mit Feinden,
jeder Zeitungsverkäufer bietet mir ein Todesurteil an,
Äpfel faulen, wenn ich sie anschaue,
das Jahr verkommt,
selbst Tauben richten Gewehre auf mich.
Es hilft kein Sträuben,
es gibt kein Bleiben,
das Jahr rennt los
und schleift mich mit.
Kann man mehr tun als in der Sonne sitzen
und hören, wie der Zug vorbeifährt
und eine Stille zurücklässt,
die es vorher nicht gegeben hat?
Wie der Tropfen in die Tiefe fällt,
als wüsste er, wo er bleibt,
rennen wir durch eine Welt,
die den Tod betreibt.

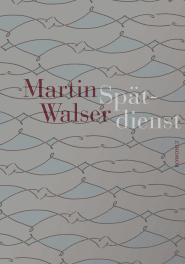
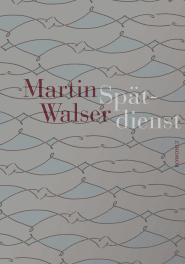

Spätdienst
«Das Alter ist ein Zwergenstaat, regiert von jungen Riesen.» Wer sagt das? Ein lyrisches Ich zwischen Glücksmomenten und Schwärze, Leere, Sturz. Beim Durchkämmen des ...