10 Fragen an Dr. Werner Bartens
Dr. Werner Bartens im Interview zu seinem neuen Buch «Leib und Seele. Eine Reise durch die Geschichte der Medizin»

Ihr neues Buch heißt „Leib und Seele“ – das gehört eigentlich zur Redewendung «Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen». Wie kamen Sie auf den Titel für Ihre Medizingeschichte, und was
erwartet die Lesenden?
Leib und Seele gehören zusammen, nicht nur beim Essen, sondern auch in der Medizin. Leidet die Seele, wird der Körper krank – und ein kranker Körper dämpft die Psyche. Leider wird das von Ärzten nicht genug beachtet. Dabei umfassten Konzepte von Gesundheit und Krankheit in der Antike und im Mittelalter schon beides. Im 19. Jahrhundert hat die Verwissenschaftlichung der Medizin jedoch zur Engführung auf naturwissenschaftliche Befunde geführt, auf das, was sich messen und vermessen lässt. Menschen leiden aber manchmal trotzdem, auch wenn Blutwerte und Kernspin unauffällig sind.
Lesende erwarten lebenspralle Geschichten von Gesunden und Kranken – und von Ärzten, die manchmal als Barbiere oder gar Henker ausgebildet waren. Mal wird es blutig und gruselig, oft amüsant. Es geht natürlich auch um Fortschritte und Errungenschaften für Patienten. Deutlich wird zudem, dass viele Ideen zu Krankheit und Heilung aus frühen Zeiten stammen und heute nur in einem anderen Gewand daherkommen. Wer wissen will, wie Ärzte ticken, sollte das Buch kennen. Zudem ist es heiter und voller Querverweise auf Gesellschaft und Kultur. Man will doch wissen, was der Boom der Pathologie mit Schneewittchens Glassarg zu tun hat, wieso in einem «Asterix»-Band auf Rembrandts Gemälde «Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp» angespielt wird und wovor Kafka zukünftige Ärzte warnt.
Es geht also um die Geschichte der Krankheiten und deren Heilung, um Ärzte und deren wichtige Entdeckungen – aber manchmal richtet auch schon ein weißer Kittel viel aus, oder?
Ja, ärztliche Handlungen haben immer auch symbolische Bedeutung. Ein frischer weißer Kittel, dazu das lässig um den Hals geschwungene Stethoskop – das vermittelt Kompetenz und Vertrauen. Im Mittelalter war das Harnglas das Erkennungszeichen des Arztes. Doktoren haben damals den Urin der Kranken probiert, um beispielsweise die Zuckerkrankheit zu diagnostizieren. Daher auch der Name: «Diabetes mellitus» heißt wörtlich «honigsüßer Durchfluss».
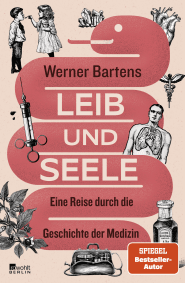

Leib und Seele
Von Aderlässen und Amputationen ohne Narkose zu Gentherapien und Schlüsselloch-OPs – die Medizin hat sich enorm entwickelt. Doch es gibt verblüffende Kontinuitäten und Traditionslinien, die Jahrhunderte zurückreichen. Was macht uns krank? Welchen Einfluss hat die Seele auf ...
Leib und Seele
Von Aderlässen und Amputationen ohne Narkose zu Gentherapien und Schlüsselloch-OPs – die Medizin hat sich enorm entwickelt. Doch es gibt verblüffende Kontinuitäten und Traditionslinien, die Jahrhunderte zurückreichen. Was macht uns krank? Welchen Einfluss hat die Seele auf ...
Sie erklären, dass der Begriff «Hospital» eigentlich auf das Wort «Gasthaus» zurückgeht, und beleuchten die Geschichte von Krankenhäusern wie der Charité, über die der Volksmund zu sagen wusste: «Die Charité tut mehr für die Dezimierung der Bevölkerung als anderswo die Guillotine.» Wie passt denn das zusammen?
Im Mittelalter entstanden Vorläufer von Krankenhäusern aus Gasthäusern oder Herbergen zum Pferdewechsel. Erschöpfte Reisende konnten dort ruhen, manche mussten bleiben, um zu Kräften zu kommen. Essen, Trinken, Ruhe, Zuwendung sind Grundpfeiler der Pflege. Zudem sahen christliche Orden die Pflege als Gebot der Nächstenliebe. Oft sind Krankenhäuser konfessionellen Ursprungs. Die Ahnung, dass man im Krankenhaus nicht gesund wird, hat sich bis heute gehalten. Hospitäler waren früher oft dreckig, Dutzende Patienten teilten sich nicht nur ein Zimmer, sondern auch den Abort. Infizierte wurden nicht abgesondert, man steckte sich gegenseitig an, Ärzte ließen sich oft erst nach Tagen blicken. Die Charité war im 18. Jahrhundert ein Schreckensort: teilweise baufällig, dazu die mangelnde Hygiene – und manchmal aßen die Ärzte den Kranken sogar das Essen weg.
Welche absurden Therapien haben Sie ausgegraben?
Ein erstaunliches Sammelsurium! Abgekochte Pferdeäpfel sollten gegen Bauchgrimmen helfen, Waschungen mit Urin Wunden heilen, Menschenfett Gliederschmerzen lindern. Zu Zeiten der Pest gab es den Vorschlag, den Hintern eines gerupften Hahns auf Pestbeulen zu setzen oder Eiter zu trinken. Bemerkenswert ist auch der Rat, keinen Fisch und kein Olivenöl zu essen sowie Bewegung zu meiden. Also das Gegenteil von dem, was heute als gesund gilt. Zudem war von der Antike bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Aderlass beliebt. Manche Kranke schwächte diese Prozedur dermaßen, dass sie daran und nicht an der Krankheit starben; Kritiker sprachen von «Vampirismus».
Welches waren die größten und womöglich folgenschwersten Irrtümer der Medizingeschichte?
Oje, da gab es viele! Ein holländischer Tuchhändler hat 1683 unter dem Mikroskop «kleines Leben», also Bakterien erkannt. Erst knapp zweihundert Jahre später griffen Robert Koch und Louis Pasteur das auf. Die Suche nach Behandlungen, etwa Antibiotika, begann mit enormer Verspätung.
Chemiker haben im Jahr 1800 beschrieben, wie gut Lachgas als Narkosemittel wirkt. Es gab überall in Europa Lachgas-Partys, aber Narkosen wurden erst Mitte der 1840er-Jahre etabliert – fast ein halbes Jahrhundert unnötige Schmerzen.
Ignaz Semmelweis konnte 1847 eindeutig nachweisen, dass der Tod Tausender Frauen am Kindbettfieber auf die dreckigen Hände der Ärzte und Medizinstudenten zurückging. Er wurde verlacht und ignoriert. Desinfektion und Antisepsis setzten sich erst mehr als zwanzig Jahre später durch.
Und der berühmte Ferdinand Sauerbruch feuerte 1929 seinen Assistenten Werner Forßmann, nachdem dieser sich im Selbstversuch einen Herzkatheter gelegt hatte. Sauerbruch sah ihn damit eher beim Zirkus als in einer «anständigen Klinik». 1956 erhielt Forßmann den Nobelpreis für eben diesen Versuch.
Ihre Reise durch die Medizin liest sich spannend wie ein Krimi, oft waren die Versuche der berühmten Ärzte genialisch, aber auch lebensgefährlich. Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Entdeckungen und Fortschritte?
Viele Entdeckungen waren nicht nur für Patienten wichtig, sondern veränderten die Sicht auf den Menschen: neue Einblicke durch Röntgen, Ultraschall oder Kernspin etwa. Auch die Entwicklung von Medikamenten ist zu nennen, erst Schmerzmittel (Narkose, dann Aspirin und Co.), später Antibiotika und Blutdrucksenker bis hin zu Krebsmitteln. Die Chirurgie hat enorme Fortschritte gemacht, man denke an frühe Amputationen ohne Betäubung und Desinfektion; heute sind Hirnchirurgie und Schlüsselloch-Operationen möglich. Auch die erste Herztransplantation zählt zu den großen Wegmarken in der Medizin. Dieser Eingriff am Herzen, das eine simple Drucksaugpumpe ist, hatte unglaubliche symbolische Bedeutung.
Andere Versuche waren spektakulär, hatten aber keine Folgen für die Medizin: Max von Pettenkofer trank 1892 Cholera-Bouillon, um zu zeigen, dass die Erreger nicht der Grund für die Krankheit sind. Er erkrankte zwar nicht, hatte aber dennoch unrecht.
Ist die Medizin und deren Forschung männlich?
Früher war sie das ausschließlich. Frauen durften nicht studieren, Ärztin werden oder forschen. Sie waren aber in der Pflege aktiv. Marie Curie war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Ausnahme. Lange Zeit wurden Frauen unterdrückt und ausgegrenzt. Während beispielsweise Watson und Crick, 1953 Entdecker der DNA-Doppelhelix, im Schulbuch stehen und den Nobelpreis bekamen, ist Rosalind Franklin herablassend behandelt und ignoriert worden, obwohl sie ebenso viel wie die beiden Männer zu dieser epochalen Entdeckung beigetragen hat.
Welche Ähnlichkeiten zu unserer heutigen Sicht auf Krankheiten und welchen roten Faden haben Sie in der Geschichte gefunden?
Am Umgang mit Seuchen hat sich nicht viel geändert. Bereits der Pest im Mittelalter begegnete man mit Masken, Abstand und Isolierung der Kranken. Der Begriff «Quarantäne» stammt aus dieser Zeit. Und 1892, als die Cholera in Hamburg wütete, ließ Robert Koch Schulen und andere Einrichtungen schließen; heute würde man Lockdown dazu sagen.
Interessant ist auch, wie Sünde, Schuld und Strafe herhalten mussten, um Krankheiten zu erklären. Diese moralische Dimension von Leid gibt es immer noch, man denke an Debatten um «schlechte» Ernährung oder eine „falsche“ Lebensführung. Vitamine bieten dann Ablass von Diätsünden.
Interessant sind auch die Kapitel über die Rivalitäten von Koryphäen wie Pasteur und Koch bzw. Koch und Virchow. Haben diese die Medizin vorangebracht, oder standen die Eitelkeiten mancher Mediziner dem Fortschritt im Wege?
Das war hinderlich! Eitelkeit hat viel Leid verursacht. Koch und Pasteur hätten sich ergänzen können, Nationalismus auf beiden Seiten stand dagegen. Virchow hat Koch zu Beginn lächerlich gemacht, das bremste die Bakteriologie aus. Virchow war es auch, der Semmelweisʼ Erklärung des Kindbettfiebers ablehnte und statt Keimen das Winterwetter oder Thrombosen als Ursache vermutete.
Es ist wichtig, wie der Arzt mit Patienten umgeht. Sie zitieren ein Lehrbuch von 1792: «Während der Erzählung soll der Arzt heiter im Gesichte sein, die Achseln nie zucken, das Gesicht verzerren, oder mit einigen bedenklichen Schritten auf- und abgehen.« Oder auch Kafka («Der Landarzt«): «Rezepte schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen, ist schwer.» Was kommt auf uns zu, wenn es auf dem Land kaum noch Ärzte gibt und haufenweise Kliniken schließen?
Die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist enorm wichtig. Ärzte tragen zur Genesung bei, wenn sie positive, realistische Erwartungen wecken, sie wirken als «Droge Arzt». Zuwendung und Zeit sind in der modernen Medizin jedoch Mangelware. Dabei machen sie die ärztliche Kunst aus, ermöglichen eine tragfähige Beziehung und ein therapeutisches Bündnis. Medizin ist keine Ingenieurwissenschaft am Menschen, sondern von Erfahrung und Verständnis geprägt – eine Heilkunde für Leib und Seele eben.
