Leipzig, 1920
Der Krieg ist vorbei, das Töten nicht: Thomas Ziebula im Interview über seinen Kriminalroman «Der rote Judas»

Inspektor Paul Stainer kehrt schwer traumatisiert aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Immer wieder quälen ihn die Erinnerungen an das Grauen der Schützengräben. Seine Frau Edith ist mittlerweile mit einem anderen Mann liiert – Stainers gesamte Welt scheint zerbrochen. Ein aufsehenerregender Kriminalfall zwingt ihn, sich mit der Gegenwart zu befassen: In der Villa eines Leipziger Fabrikanten werden mehrere Menschen erschossen – ein missglückter Einbruch? Eine verängstigte Zeugin und ein Koffer voll brisanter Dokumente über die Kriegsführung der deutschen Reichswehr im besetzten Belgien führen Stainer auf die Spur der «Operation Judas». Bald steht er selbst auf der Todesliste der Fememörder ...
Das Interview
Kurz vor der Jahreswende 2020 wurde in einer Sonderausgabe des ZEIT Magazins beschrieben, wie die Menschen im Jahr 1010 gelebt und gearbeitet haben, was sie glaubten, wovon sie träumten. Sie gehen in «Der rote Judas» ein Jahrhundert zurück. Weshalb haben Sie Ihren ersten Kriminalroman im Jahr 1920 angesiedelt – und nicht zum Beispiel 1930?
1930, tja, da fragen Sie mich was. Man denkt sofort die Jahreszahl 1933, und das fühlt sich monströs an, oder? Zumal nach den vielgepriesenen «Goldenen Zwanzigern», die vorausgingen. Waren die wirklich so «golden», oder hatte die Zeit da eine Werbeagentur engagiert, um sich uns Nachgeborenen in günstigem Licht zu präsentieren? Sicher – an den Ersten Weltkrieg zu denken und an 1918, 1919 und so fort, das fühlt sich erst einmal auch monströs an. Wer vermag sich schon vorzustellen, was damals los war? Ich konnte das nicht wirklich vor der Arbeit an diesem Buch. Und wer will sich schon vorstellen, was 1933 los war? Ich glaube, ich will den Weg verstehen, den die deutsche Gesellschaft von 1918 bis 1933 gegangen ist, also setze ich meine Figuren auf diesen Weg, begleite sie, versuche zu sehen und zu fühlen, was sie sehen und fühlen, und mit ein bisschen Glück und Geschick lernen ich und meine Leser*innen ein wenig zu verstehen. Danach schauen wir mal, wie monströs 1933 sich noch anfühlen wird.
Man hätte sich die Geschichte um die «Operation Judas» auch gut in Berlin oder Hamburg, in den Zentren der deutschen Arbeiterbewegung, vorstellen können. Sie scheinen ein besonderes Faible für Leipzig zu besitzen. Was fasziniert Sie an Ihrer erklärten «deutschen Lieblingsstadt»?
Als ich 1998 zum ersten Mal mit dem Zug nach Leipzig hineinrollte, sah ich durchs Waggonfenster eine riesige Kuppel aus Backstein und zerbrochenem Glas aus den Sommerbäumen herausragen, eine Industrieruine, vermute ich. Die hat mich sofort fasziniert. In der Stadt dann alte heruntergekommene Häuser neben frisch renovierten und altes Kopfsteinpflaster zwischen neu asphaltierten Strecken. In der Kneipe dann offene Gesichter, kontaktfreudige Menschen und Musiker, die eine Art Wohnzimmerkonzert für Freunde gaben. Weil mein Jüngster in Leipzig studiert hat, kam ich in den Nullerjahren öfter in die Stadt – und siehe da und bis heute: Immer noch folgt in etlichen Vierteln Neoklassizismus auf Brachfeld und restaurierter Jugendstil auf Ruine. Manches Viertel ist noch immer leicht bis mittelschwer angesifft, was ich charmant finde, in den wenigsten Kneipen trifft man auf Schickimickigehabe, und in der Stadt herrscht eine irgendwie lässige Atmosphäre, in der einer wie ich durchatmen kann. Vor allem in der Südvorstadt und in Connewitz, dem «politisch korrektesten Viertel Deutschlands», wie mein Jüngster behauptet. Und dann natürlich «der Leipziger an sich» … Ich höre jetzt lieber auf. Was fasziniert mich an meiner deutschen Lieblingsstadt? Hier noch die Kurzversion meiner Antwort: dass sie so unperfekt ist.
Einige Stichworte zum historischen Kontext Ihres Kriminalromans: Russische Revolution, Erster Weltkrieg, Abdankung des Kaisers, Ausrufung der Republik, Versailler Vertrag, Straßenkämpfe, Arbeiter- und Soldatenräte, Fememorde der Schwarzen Reichswehr usw. Wie gut waren Sie mit dieser Materie vertraut, bevor Sie mit der Niederschrift des Romans begannen? Der Rechercheaufwand für den Roman muss immens gewesen sein ...
«Vertraut», tja … Als Vielleser und Zeitungsjunkie wusste ich natürlich dies und das, doch vertraut? Nach der Recherchearbeit muss ich im Rückblick antworten: nicht gut. Das ist jetzt anders, klar, und so allmählich werde ich mit dieser Zeit und ihren Erscheinungen ein wenig vertrauter. Die Recherchen waren tatsächlich aufwendig, da haben Sie recht. Meine Erfahrung mit dem Schreiben historischer Romane: Je sorgfältiger der Autor sich hineinkniet in die Recherche, desto leichter fällt ihm das Erzählen. Und den Leser*innen das Lesen, vermute ich mal. Ich hatte auch einiges Glück: Gleich bei meiner ersten Recherche-Reise nach Leipzig bin ich in der Wächterburg (dem alten Leipziger Polizeigefängnis, d. R.) einem Beamten über den Weg gelaufen, der mir den Namen eines Polizeihistorikers nannte, eines Ersten Hauptkommissars a. D. Der hat zwei dicke Bücher über die Geschichte der Leipziger Polizei geschrieben. Wir haben uns in Leipzig getroffen und pflegen bis heute Kontakt
Wie sind Sie auf das Massaker von Dinant gestoßen, als im August 1914 sächsische Truppen der kaiserlich-deutschen Armee ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung der belgischen Ardennenstadt anrichteten?
Durch ein dickes Buch (Gerd Hankel: Die Leipziger Prozesse, Hamburg 2003), das die Verfahren des Reichsgerichts gegen zahlreiche Reichswehrangehörige dokumentiert – und damit natürlich auch die Kriegsverbrechen, die ihnen vorgeworfen wurden. Etwa die Zerstörung der alten Universitätsbibliothek von Löwen, die Versenkung ziviler Schiffe oder eben die Massaker von Dinant. All das spielt ja zusammen mit der Namensliste der später Angeklagten eine entscheidende Rolle in Paul Stainers erstem Fall. Es wurden übrigens in zwölf Verfahren nur 17 Soldaten angeklagt, von denen man acht zu milden Freiheitsstrafen verurteilt hat. Etwa 1.700 begonnene Verfahren wurden bis 1927 (also während der sog. «Goldenen Zwanziger») eingestellt. Die mit den Prozessen befassten Juristen waren überwiegend Weltkriegsteilnehmer und Reserveoffiziere.
Aus diesen Erfahrungen klug geworden, haben die Alliierten die Nürnberger Prozesse 1945/46 lieber nicht der deutschen Justiz überlassen.
Was viele Leser*innen brennend interessieren dürfte: Ist «Der rote Judas» ein Stand-alone oder Auftakt zu einer Serie? Wäre schon schade, wenn die Geschichte um den aus dem Weltkrieg heimgekehrten Kriminalkommissar Paul Stainer und seinen Kollegen Siegfried Junghans hier schon zu Ende wäre ...
Tatsächlich versuchen wir, eine Krimireihe in den Buchdschungel zu pflanzen. So ist die Erzählung auch angelegt: Rosa Sonntag, die zerbrechliche Tänzerin; der korrekte Turnerchampion Kommissar Heinze; der brave Oberwachtmeister Kupfer; Josephine, die toughe «Königin der Elektrischen»; ihre eigensinnige Tochter und der schlaue Junghans – die alle sollen sich, wenn’s nach dem Verlag und mir geht, noch weiterentwickeln. Und was die turbulente Zeitgeschichte betrifft, gibt es noch viel Stoff zu verarbeiten. Mal sehen, wie die Leser*innen darüber denken werden. Zwei weitere Fälle mit diesen fiktiven Mitmenschen und Paul Stainer sind bereits angedacht und liegen teilweise schon in der Textschmiede.
Wirft man einen Blick auf die Publikationsliste des Thomas Ziebula, meint man, einen Wanderer zwischen den Genres zu sehen. Science-Fiction, Fantasy, Kinderbuch, Krimi – wie schaffen Sie es, Ihre literarische Fantasie in so unterschiedlichen Welten schweifen zu lassen?
Kommt Ihnen das schwierig vor? Mir gar nicht. Ich liebe es einfach, Geschichten zu erzählen, also: Frau trifft Mann trifft Frau trifft Mann, es wird geliebt, getötet, gelitten, gestorben. In welchen Anzug bzw. welches Kleid ich das Drama stecke oder mit welchen spezifischen Zutaten ich es würze, scheint mir erst einmal nebensächlich zu sein.
Letzte Frage, quasi off the record: Mehrfach werden im Roman die großen Leipziger Fußballvereine erwähnt, allen voran der VfB Leipzig, der bis 1918 drei deutsche Meistertitel holte. Sie leben mit Ihrer Familie in der Nähe von Karlsruhe. Für wen schlägt Ihr Fußballherz lauter – für den Karlsruher SC oder RB Leipzig?
Oh! Da stoßen Sie das Tor zu einem weiten Feld auf. Wenn ich mich kurzfassen wollte, würde ich sagen: für RB Leipzig.
Doch sich beim Fußball kurzzufassen ist so eine Sache, deswegen noch dies: Ich mag den Verein nicht so sehr wegen der Stadt, sondern wegen eines Lehrers aus Backnang, Schwaben, der als Trainer erst einen Fußballclub aus Ulm, Schwaben, aus den sportlichen Niederungen in die Bundesliga führte, dann die TSG 1899 Hoffenheim, Baden (die es 2017 sogar bis in die Champions League schaffte) – und der sich danach RB Leipzig, Sachsen, zur Brust nahm. Natürlich ging er auf diesem Weg auch durch so manches Tal. So, jetzt habe ich en passant verraten, warum ich Fußball mag: wegen der Geschichten, die er schreibt. Nebenbei: Der Mann heißt Ralf Rangnick und ist vielleicht der einzige Lehrer, den ich verehre. Und ich schwöre: Ich musste viel zu vielen begegnen.
Zum Thema Fußballherz & Vereinstreue nur noch dies: Ich habe in den Neunzigern eine Zeitlang in Dortmund gelebt, und meine Söhne, damals noch klein, zwangen mich, mit ihnen ins Westfalenstadion zu gehen. Durch die gewonnenen Meisterschaften jener Jahre erlebte ich mehrfach eine ganze Stadt im Rausch. So verfiel ich Borussia Dortmund.
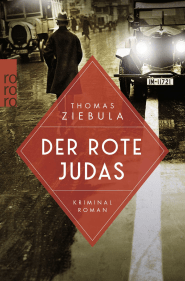
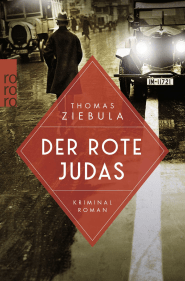
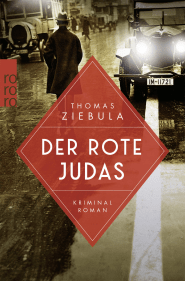
Der rote Judas
Hervorragend recherchiert, lebendig und fesselnd!
Der Krieg ist vorbei, das Töten ist es nicht ...
Leipzig in den Nachkriegswirren 1920. Kriminalinspektor Paul Stainer kehrt aus der ...
Der rote Judas
Hervorragend recherchiert, lebendig und fesselnd!
Der Krieg ist vorbei, das Töten ist es nicht ...
Leipzig in den Nachkriegswirren 1920. Kriminalinspektor Paul Stainer kehrt aus der ...
Der rote Judas
DER KRIEG IST VORBEI, DAS TÖTEN IST ES NICHT…
Inspektor Paul Stainer kehrt schwer traumatisiert aus der Kriegsgefangenschaft zurück – und wird gleich mit einer rätselhaften Mordserie konfrontiert: ein Gymnasiallehrer, in seiner eigenen Wohnung ...
