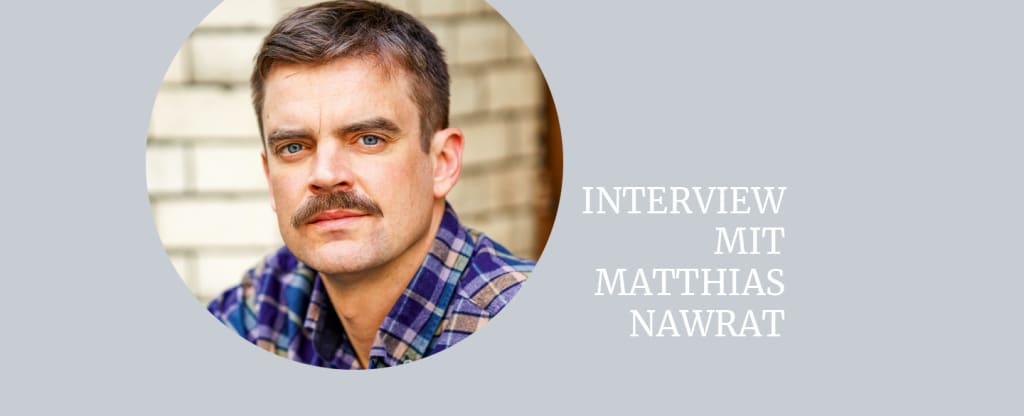Ein Schriftsteller bricht kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump zu einer USA-Reise auf: zunächst nach New York City, dann weiter Richtung Maine. An seiner Seite: seine Mutter Celina, die vor dreißig Jahren aus Osteuropa ins Fränkische gekommen ist. Celina hat ihrem Sohn kurz vor der Abreise eröffnet, dass sie, anstatt die zweite Reisewoche bei einem Jugendfreund in Texas zu verbringen, die ganze Zeit mit ihm zusammenbleiben wird. Dann hat sie auch noch einen Unfall, muss sich in New York im Krankenhaus behandeln lassen. Auf der Autoreise an die Küste Neuenglands beginnt ein Konflikt aufzubrechen, der viel darüber verrät, wie Männer mit Frauen, wie Mütter mit Söhnen sprechen, ein Konflikt, der nicht nur das Leben der beiden und ihr Verhältnis zueinander prägt.
Das Interview
Eine Frage, die kein Autor mag, die sich aber bei Ihrem neuen Roman ebenso stellt wie schon bei «Die vielen Tode unseres Opas Jurek» (2015): Wie viel Ihrer eigenen Familiengeschichte steckt in «Reise nach Maine»?
Je nachdem, wie man schaut. Vor ein paar Jahren habe ich eine Reise mit meiner Mutter nach New York gemacht. Und sie hatte dort einen Unfall. Und wir sind dann mit dem Auto die Küste hinauf bis nach Maine gefahren. So weit, so gut. Viele Fakten stimmen überein. Aber die zwei Figuren in meinem Buch sind nicht meine Mutter und ich – ich habe in dem Buch einen Konflikt verdichtet, von dem ich glaube, dass er zwischen allen erwachsenen Kindern und Müttern schwelt, auf die eine oder andere Weise. Das Aushandeln von Nähe und Distanz, von Gefühlen wie Schuld, Sorge, Liebe und Wut, die Unmöglichkeit, aus dieser Urbeziehung zu entkommen – alles das sind Aspekte dieser Beziehung, die auf die eine oder andere Weise universal sind. So auch die schönen Momente, die Zuneigung.
In meinem Roman kommen die Begegnungen unterwegs hinzu, die man als Tourist erlebt. Der Tourist ist ja ohnehin eine der typischen Figuren unserer Zeit. Er blickt kurz in die Leben der Menschen hinein, wird aber sofort weitergezogen. Auch hier habe ich vieles verdichtet, indem ich ausgehend von realen Begegnungen die Dinge weitergedacht, Leben neu erfunden habe, denn der Erzähler wehrt sich gegen dieses Weitergezogen-Werden, er will den Menschen gerecht werden. Ich versuche in allen meinen Büchern, der Realität des menschlichen Lebens näherzukommen, auch meines eigenen, indem ich die Realität neu erfinde.
Das Hadern mit der Vergangenheit, die Unvereinbarkeit von Lebensentwürfen, das sprachlose Umkreisen schwieriger Themen – um all das geht es in der «Reise nach Maine». Wenn die Mutter des Protagonisten sagt, im Leben ihres Sohnes gebe es «keinen festen Punkt», keine Stabilität, keine Verbindlichkeit, keine Verantwortung für irgendetwas, dann weicht er aus, verharrt in der Defensive. Weshalb?
Auch dies ist ja ein Urkonflikt zwischen Mutter und Kind. Die Mutter hat ein Leben geführt, auf dem das Leben des Sohnes aufbaut. Die Figur der Mutter im Roman war gezwungen, durch den täglichen Überlebenskampf in einer neuen Welt, sich festzulegen, Entscheidungen zu treffen, zu bleiben, wenn man so will. Und was macht er daraus? Er ergreift einen prekären Beruf, zieht alle paar Jahre um, hat noch lange keine Kinder. Als wäre er ein Tourist in seinem eigenen Leben. Und warum ist er außerdem ständig unglücklich? Gleichzeitig aber sieht der Sohn, dass die Mutter mit ihrem Leben hadert. Er sieht, dass ihr die Geschichte bestimmte Entscheidungen auferlegt, ein Schicksal aufgeladen hat – sie wollte vielleicht ein ganz anderes Leben führen. Die Defensive, sein Rückzug bedeuten vielleicht, dass er sich nicht auf den Konflikt einlassen will, weil er der Mutter nicht wehtun will – und er will sich vielleicht auch nicht mit seinem eigenen Leben konfrontieren, mit dem er vielleicht tatsächlich nicht ganz zufrieden ist. Beide versuchen, ihre Lebensentscheidungen nicht zu hinterfragen. Hinzu kommt die spezifische Ausprägung unserer Gegenwart. Die Mutter hat eine Auswanderung aus einem anderen System hinter sich, die Erniedrigungen einer gesellschaftlichen Aufsteigerin. Der Sohn hingegen ist praktisch auf dem schon sicheren Boden ihrer Arbeit und ihrer «Verdienste» aufgewachsen, ist Teil einer neuen europäischen mobilen Klasse, die mit Verwurzelung, Herkunft und Geschichte hadert, die Verantwortung scheut und die grenzenlose Freiheit sucht, die Utopie des Kapitalismus. Das «instabile Gleichgewicht» in einer Familie stört man lieber nicht – es sei denn, man will die Büchse der Pandora öffnen. Die Frage ist nur, wie lange das gut geht, auf einer Reise zu zweit.
Hat es Sie während des Schreibens nicht manchmal in den Fingern gejuckt, dem Thema «Trump» einen größeren Raum im Roman zu geben?
Ich kann mir keine literarisch weniger interessante Figur als Trump vorstellen. Er ist ja schon in der Wirklichkeit eine unglaubwürdige Figur, was soll man da noch erfinden? Zudem macht mich die Häme, die in Deutschland Trump und Amerika entgegengebracht wurde, wütend. Trump war (und ist übrigens noch immer) eine reale Tragödie, deren Anschauung viel über unsere deutsche derzeitige Tragödie verrät, nicht nur über Amerika. Deutsche und Europäer ganz allgemein verschließen gern den Blick vor ihren eigenen Leichen im Keller und lachen über Amerika. In den Medien war die Berichterstattung über Trump omnipräsent – was hat er heute wieder gesagt oder getwittert, wie sieht seine Frisur auf diesem oder jenem Foto wieder aus. Als wäre Deutschland nicht auch ein Land voller Nazis – oder bürgerlicher selbstgerechter Eliten, die sich für moralisch überlegen halten. Es ist klar, warum Trump in Deutschland so im Zentrum stand, denn Amerika ist noch immer das Imperium, dessen kleingeistige Provinz wir sind. Und Trump hat uns eine Art Katharsis erlaubt, wir haben uns in diesem Spiegel als moralisch überlegen gefühlt. Daher die Arroganz und die Überheblichkeit, es ist im Grunde ein mickriger Charakterzug. Für mich ist Amerika etwas völlig anderes. Es ist nach wie vor das Land, das Europa aus der tiefsten Unmenschlichkeit der Geschichte herausgeholt hat. Und Amerika ist ein brutales Land, ja, ein Gewalt ausübendes Land, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Aber es ist auch ein Land voll kluger Menschen, die über unsere Gegenwart nachdenken, die ihre Leben zu führen versuchen und in ihrem Alltag kämpfen. Ich habe mich eher für diese Menschen interessiert und für die Probleme, die sie haben.
Eine Textstelle: «Aus diesem Grund sage ich dir ja immer, dass du einen richtigen Beruf brauchst. Du brauchst eine richtige Stelle, wo du ein richtiges Gehalt bekommst. Schreiben kannst du jederzeit nebenbei, als Hobby. Es ist aber kein Hobby, sagte ich. Ich finde schon, sagte meine Mutter.» Haben Sie sich das jemals selbst gefragt: Schreiben – vielleicht doch nur ein Hobby?
Nein. Ich beherrsche es nicht, Dinge, die mir wichtig sind, als Hobby zu betreiben. Ich kann die Dinge dann nur ganz oder gar nicht machen. Das war schon in meiner Jugend so, als ich ein weltberühmter Basketballspieler werden wollte oder mit meiner Band direkt ein genialer Musiker und später im Studium ein nobelpreisverdächtiger Wissenschaftler und so weiter. Beim Schreiben war es genauso, mit dem Unterschied, dass ich aus irgendeinem Grund trotz der Jahre des Misserfolgs mit dem Schreiben weitergemacht habe. Mit dem Sport, der Musik und dem wissenschaftlichen Arbeiten habe ich aufgehört, als ich merkte, dass ich richtig Arbeit investieren müsste. Am Schreiben habe ich hart gearbeitet, ich habe auch in Kauf genommen, dass ich mein Leben lang nicht viel Geld haben und vielleicht einsam werden würde. Und das, obwohl mir alle gesagt haben, dass ich doch vielleicht etwas Richtiges machen und das Schreiben nur als Hobby betrachten sollte. Aber das Schreiben kann kein Hobby sein. Die Literatur ist eine Art mönchische Selbstaufopferung für andere, zumindest so, wie ich sie verstehe. Abgesehen davon, dass ich natürlich noch immer auf Fame und Geld hoffe!
Unter dem grazilen Titel «Der Mückenschwarm. Poetologische Fragmente, am Kern vorbei» haben Sie sich mit Ihrem eigenen Schreiben auseinandergesetzt. Die These, auf die das Ganze zuläuft: «Sicher hat jeder Text etwas mit meinen realen Erfahrungen zu tun. Aber keine Spur der realen Erfahrung darf am Ende in einem Text enthalten sein.» Das klingt ziemlich rigide …
Es hat etwas mit der Frage zu tun, was Literatur ist. Und sie ist sicher keine Nabelschau des Autors oder der Autorin. Die eigene Erfahrung kann nur Substrat sein, Grundlage – aber erzählen will ich etwas, das auch andere angeht. Daher muss die Sprache eine sein, die von der konkreten Erfahrung ausgehend die Verbindung zur «condition humaine» sucht. Es geht um das Leben der Menschen, nicht um mein privates. Die literarische Sprache ist geformt, sie ist nicht einfach Ausdruck des Erlebens. Sie bringt etwas in Form und erhebt es auf die Höhe der allgemeineren Wahrheit (oder zumindest versuche ich das immer). Diese Distanz verwandelt die eigene Erfahrung. Wenn ich nur über mich und meine Erlebnisse etc. schreibe, dann erscheint mir das sehr unangenehm, ich will auch bei anderen keinen ungeformten Erlebnisbericht lesen, egal über was. Literatur ist etwas vollständig anderes als die Realität. Nur deshalb können wir durch die literarische Sprache die Wirklichkeit überhaupt erkennen – weil Literatur Distanz herstellt.
Sie sind als Kind mit Ihrer Familie aus Opole (Polen) ins Fränkische gekommen, nach Bamberg, Sie haben im schweizerischen Biel studiert, leben in Berlin. Eine schöne europäische Autorenbiografie, könnte man sagen. Schärft das die Sensibilität für Themen wie Migration und Heimatlosigkeit?
Mein Leben wird zum Beispiel maßgeblich geprägt von einem Bild, das ich nicht mehr loswerde, nämlich das der jungen Männer mit den Kalaschnikows und den Schäferhunden an der Grenze zwischen der Volksrepublik Polen und der DDR und dann an der deutsch-deutschen Grenze, Anfang 1989, als wir mit dem Auto den Ostblock verließen. Darin verdichtet sich das ganze Problem: die Utopie des Grenzübertritts in eine freiere Welt und die Brutalität der historisch gemachten Schranke, die mich davon abhalten soll, diese Grenze zu überschreiten. Die Mobilität, die für die meisten Westeuropäer meiner Generation aufgrund ihrer Privilegiertheit eine romantische, freiheitliche, globale Seinsweise bedeutet, trägt für mich die ganze Tragödie der menschengemachten Geschichte in sich. Auf der einen Seite ist die Utopie, auf der anderen Seite der Tod. Heute etwa im Mittelmeer. Aber auch gibt es die brutalen unsichtbaren Grenzen innerhalb der europäischen Länder auf den Ämtern. Oder in den Ländern, in die wir unsere Produktion ausgelagert haben. Etc. Die Erfahrung, nicht dazuzugehören, habe ich als Jugendlicher in Deutschland gemacht, und die ist immer noch in mir drin. Wenn ich auf Deutschland schaue, dann sehe ich diejenigen, die diese Erfahrung tagein, tagaus machen, und die Leute, die das nicht sehen können oder wollen.
Sie haben in den vergangenen zehn Jahren eine Menge Auszeichnungen und Stipendien erhalten: vom Silberschweinpreis der LitCologne über den Klagenfurter Kelag-Preis, die Alfred-Döblin-Medaille der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz bis zum Literaturpreis der Europäischen Union; mit «Unternehmer» standen Sie 2014 auf der Longlist beim Deutschen Buchpreis. Wie wichtig ist all dies – neben Buchverträgen und Lesungen – für die ökonomische Basis Ihres Lebens als freier Schriftsteller?
Meine Erfahrung ist, dass in den Gesellschaften, in denen wir heute leben, Geld die einzige relevante Form von Wertschätzung ist. Was soll eine Pflegekraft damit anfangen, dass Leute auf dem Balkon stehen und applaudieren? Genauso ist es im Kulturbereich. So schön auch ein Händedruck ist oder der Vergleich mit einem großen Meister, einer großen Meisterin, vorgetragen auf einer Bühne – am Ende zählt, ob ich vom Schreiben leben kann oder nicht. Ob ich noch einen oder mehrere andere Jobs nebenbei machen muss. Ob ich mir einen Urlaub leisten kann. Ob meine Kinder auf die Schulausflüge mitkönnen etc.
Wie in jedem anderen Beruf auch: Auszeichnungen sind schön und schmeichelhaft. Aber einer Auszeichnung haftet immer auch der Hauch von Ungerechtigkeit an, denn andere haben sie ja im selben Moment, in dem man sie bekommt, nicht bekommen, und häufig gar nicht deshalb, weil sie schlechtere Arbeit geleistet haben, sondern weil sie das falsche Geschlecht, die falsche Biografie, die falsche Hautfarbe, den falschen habituellen Hintergrund oder sich dem falschen Thema gewidmet etc. haben. Und die können dann also nicht von ihrer Arbeit leben. Mir ist absolut bewusst, dass ich in den letzten Jahren nur deshalb Zeit hatte, meine sechs Bücher zu schreiben, weil ich diese Preise bekommen habe und zu Veranstaltungen eingeladen worden bin.