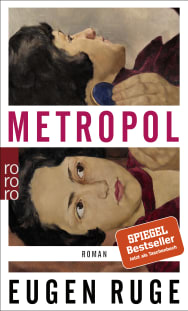Eine deutsche Kommunistin entkommt Mitte der 1930er Jahre den Nazis, reist unter dem Decknamen Lotte Germaine als Mitarbeiterin des Nachrichtendienstes der Komintern durchs stalinistische Moskau, erlebt in ihrem engsten Umfeld – ideologisch vollkommen überzeugt – Willkür, politischen Terror, allgegenwärtige Verdächtigungen und Denunziationen. Es ist die Geschichte von Eugen Ruges Großmutter Charlotte Ruge, die ebenfalls Mitarbeiterin des Nachrichtendienstes der Komintern in Moskau war und gemeinsam mit ihrem Mann im berühmten Hotel Metropol auf ihre mögliche Verhaftung wartete. Eine Episode ihres Lebens, die sie mit ins Grab nehmen wollte. «Du hast dein Leben lang daran gearbeitet, sie vergessen zu machen, sie zu löschen aus deinem, aus unserem Gedächtnis. Fast ist es dir gelungen», schreibt Ruge, der seine Familiengeschichte bereits im preisgekrönten Debütroman «In Zeiten des abnehmenden Lichts» aufgriff.
DAS INTERVIEW
Was für eine Frau war Ihre Großmutter?
Zunächst einmal muss man zwischen der Figur der Charlotte und meiner Großmutter unterscheiden. Auch wenn die Romanfigur über alle Lebensdaten meiner Großmutter verfügt, ist sie mein Produkt, das ich so lange in meinem Hirn durchgewalkt habe, bis es zu einer literarischen Figur geworden ist. Meiner tatsächlichen Großmutter habe ich dabei vielleicht etwas angetan, was nicht ganz gerecht ist.
Was glauben Sie, ihr angetan zu haben?
In meinen beiden Romanen tritt sie oft als komplizierte, manchmal geltungsbedürftige, zum Drama neigende Person auf. Das war sie auch, aber sie war auch anders. Zwar war sie, etwa im Vergleich zu meiner russischen Großmutter, nicht besonders großmütterlich, aber ich stelle immer wieder fest, dass sie mir viel gegeben hat.
Was genau hat Sie Ihnen gegeben?
Sie war eine große Erzählerin, hat mir von ihren abenteuerlichen Unternehmungen in Mexiko berichtet, hat versucht, mich mit der aztekischen Kunst bekannt zu machen (etwas verfrüht) oder mir von den großen mexikanischen Wandmalern vorgeschwärmt, sie hat ganze Romane nacherzählt und mit mir zusammen mein erstes englisches Buch gelesen («Murder in the Orient Express» von Agatha Christie). Allerdings musste ich auch ziemlich häufig ihren Rasen mähen und beim ständigen Umpflanzen behilflich sein. Sie war ein unruhiger Mensch.
Ihre Beschreibung klingt nach einer tiefgründigen Persönlichkeit. An einer Stelle im Buch kritisiert die fiktive Charlotte das Verhalten eines Nachrichtendienst-Kollegen mit den Worten: «Seine ständigen Komplimente, sein notorisches Bemühen, einer Frau in den Mantel zu helfen oder die Tür aufzuhalten. Als wäre eine Kommunistin dazu nicht selbst imstande!» Wie emanzipiert haben Sie Ihre Großmutter erlebt?
Sie war emanzipiert, in dem Sinne, dass sie ihr eigenes Geld verdiente und eine gesellschaftlich anerkannte Arbeit ausübte – im Gegensatz zu ihrem Mann, der in späteren Jahren in der DDR lediglich Wohnbezirksparteisekretär war. Sie hielt sich auch für klüger und lebensgewandter. Aber sie war immer sehr darauf aus, ihn diese Überlegenheit nicht spüren zu lassen, seinen männlichen Stolz nicht zu verletzen. Das Wort feministisch wäre ihr fremd gewesen. Auch hat sie in der Zeit, da ich sie kannte, durchaus Wert auf bürgerliche Manieren gelegt. Wenn ihr jemand in den Mantel half, fand sie das charmant. Aber damals in Moskau war sie sehr stark dem Verhaltenskodex einer neuen herrschenden Klasse verhaftet. Gerade wenn eine solche Klasse neu entsteht, werden Verhaltenskodizes besonders wichtig, wie man übrigens auch heute an den Sprachregelungen und dem sittlichen Eifer einer neu entstehenden akademisch-kosmopolitischen Klasse erkennt.
Welches Bild hatten Sie von Charlotte, bevor Sie mit der Arbeit an Ihrem Roman begannen?
Mein Vater war ziemlich überzeugt davon, dass meine Großmutter eine unrühmliche Rolle in der Zeit der großen Denunziationen gespielt hat. Er hätte, wie ich nach seinem Tod erfahren habe, die Dokumente aus dem Komintern-Archiv über seine Mutter bestellen können, aber er wollte es nicht, weil er fürchtete, es würden schlimme Dinge zum Vorschein kommen. Aber es war dann umgekehrt: Sie oder ihr Lebensgefährte wurden denunziert.
Inwiefern hat sich das Bild Ihrer Großmutter durch Ihre Recherche verändert?
Eigentlich haben mir beide Elternteile ein eher zwiespältiges Bild von meiner Großmutter vermittelt, und das hat sich für mich im Laufe der Arbeit am Roman aufgehellt. Während des Schreibens habe ich verschiedene Phasen durchgemacht. Nach der Faszination gab es Wut darüber, dass sie wirklich absolut über das alles geschwiegen hat. Obwohl ich ihr Schweigen politisch falsch finde, fand ich es nach und nach aber auch irgendwie heroisch, dass sie tatsächlich niemals versucht hat, sich wenigstens im Privaten über diese Zeit zu beschweren, dass sie nie gejammert oder sich als Opfer dargestellt hat. Sie hat das wirklich mit ins Grab genommen.
Gab es eine Erkenntnis, die Sie im Nachhinein überrascht hat?
Ich habe ihr ein außereheliches Verhältnis immer zugetraut. Nun habe ich erfahren, dass sie offenbar wirklich ein Verhältnis mit dem Chef der deutschen Sektion der Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter hatte. Nicht dass ich außereheliche Verhältnisse bedingungslos befürworten möchte, aber bei meiner Großmutter, die ja eher zu bürgerlich-konservativen Moralvorstellungen neigte, fand ich das schon, wie soll ich sagen: irre.
Im Rahmen Ihrer Recherche waren Sie auch im Hotel Metropol in Moskau. Dort übernachteten Sie im selben Zimmer, in dem Charlotte während ihrer Suspendierung vom Nachrichtendienst untergebracht war. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Klar habe ich mal kurz überlegt, ob ein Molekül der Atemluft meiner Großmutter noch im Raum sein könnte, aber ich glaube, da war keins. Ich hatte nicht das Gefühl, dem Geist meiner Großmutter zu begegnen. Und doch war es verrückt, in demselben Raum zu sein, nur durch die Zeit getrennt, diese seltsame Gesellin. Und seltsamerweise bin ich nachts um halb vier aufgewacht, die Uhrzeit, wenn das NKWD (Anm. d. Red.: Volkskommissariat für innere Angelegenheiten) üblicherweise seine Verhaftungen durchführte, und habe mich – leider sehr unscharf – an einen Traum erinnert, den ich dann im Epilog des Romans auch erwähne. Er enthielt lauter fiebrige Nachrichten aus dem Jahr 1937.
Gab es im Rahmen Ihrer Recherche etwas, das Sie besonders berührt hat?
Von den dreißig oder vierzig Büchern, die ich im thematischen Umfeld gelesen habe, hat mich besonders das Tagebuch der Julia Pjatnitzkaja berührt. Sie war die Ehefrau eines bedeutenden Altbolschewiken, der erschossen wurde. Besonders schlimm war, wie diese Frau, eine mutige, standhafte Kommunistin, allmählich anfing, an ihrem Mann zu zweifeln, der natürlich vollkommen unschuldig war.
Was bedeutet die Auseinandersetzung mit Ihrer Familiengeschichte für Sie – eine Art Aufarbeitung?
Auf jeden Fall ist der Roman keine Aufarbeitung des Stalinismus. Zwar wird, wer sich ein wenig in der Geschichte auskennt, bemerken, dass das, was ich über den Geheimdienst OMS und insbesondere über seine Abwicklung und die Verhaftung seiner Mitarbeiter offenbare, durchaus unerforscht und ist und Neuigkeitswert hat. Aber darum geht es gar nicht. Wer von einem Roman Geschichtsforschung erwartet, hat nicht verstanden, was Literatur ist. In «Metropol» geht es um Menschen, nämlich darum, wie Menschen es fertigbringen, allen Fakten und aller Vernunft zum Trotz einen Glauben aufrechtzuerhalten. Es geht um die Funktionsweise von Ideologie, aber nicht als Theorie, sondern in Form der Geschichte meiner Großmutter und der anderen Protagonisten. Der Stalinismus war besonders irrsinnig, deswegen eignet er sich als Szenerie vielleicht besonders gut. Allerdings ist der Irrsinn mit dem Stalinismus nicht ausgestorben, auch wenn – zumindest bei uns in Europa – keine Menschen mehr aufgrund irgendeiner falschen Denunziation oder Abweichung erschossen werden.
Auf welchen «Irrsinn» spielen Sie an?
Auch heute glauben Menschen vor allem das, was für sie aus bestimmten Gründen am vorteilhaftesten ist, psychisch oder materiell. Und das kann der größte Blödsinn sein: dass es den Holocaust nicht gab oder dass die Juden heimlich die Welt regieren. Aber Vorsicht! Nicht nur der Mob hat sich von verbrecherischen Ideologien infizieren lassen, sondern eben auch Intellektuelle. Und über diese schreibe ich vor allem, über kluge und gutwillige Menschen wie zum Beispiel meine Großmutter oder den Schriftsteller Lionel Feuchtwanger, der auch in meinem Roman vorkommt. Intelligenz schützt nicht vor der Ideologisierung, weder gestern noch heute. Dieser Zusammenhang zur Gegenwart hat es mir, glaube ich, möglich gemacht, die Geschichte zu schreiben. Andernfalls hätte ich gar nicht die Energie aufgebracht.