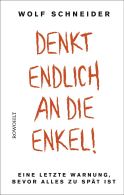«Die Welt braucht eine Vollbremsung»
Klimakatastrophe, Artensterben, Todeszonen: ein Interview mit der Meeresbiologin Heike Vesper

Heike Vesper, Meeresbiologin, WWF-Direktorin und leidenschaftliche Taucherin, erzählt hier von der Faszination des Lebens unter Wasser, vom Kampf um den Schutz der Weltmeere vor Überfischung, von Ausbeutung und Verschmutzung und der Bedeutung der Meere für das Überleben der Menschheit. Sie zeigt: Es ist noch nicht zu spät, um diesen einmaligen Lebensraum zu schützen. Welche Möglichkeiten gibt es, die Dinge anders zu machen? Und wie können wir alle durch unser Verhalten Teil dieses längst überfälligen Umdenkens sein? «Meine Grundhaltung ist es schon immer gewesen, dranzubleiben. Denn wer aufgibt, hat schon verloren.»
Das Interview
Sie bezeichnen das Meer als Ihre «innere Heimat», als Glücks- und Kraftort. Wann und wodurch wurde Ihnen klar, dass das Meer auch Ihre berufliche Zukunft sein könnte?
Die Erkenntnis, dass mein Lieblingsort auch mein Berufsfeld sein kann, hatte ich auf einem Felsen sitzend an der schottischen Atlantikküste als 18-Jährige. Während ich mit Vergnügen aufs Meer guckte, fuhr eine Gruppe von Studenten vor. Die Aufschrift auf dem Minibus gab klar zu erkennen, dass die jungen Leute, die hier ihre Ausrüstung auspackten, zur Meeresbiologischen Fakultät gehörten. Biologie hat mich in der Schule fasziniert. Die «Mechanik» des Lebens, welche kleinen und kleinsten Zahnräder ineinandergreifen müssen, damit überhaupt irgendein chemisch-biologischer Prozess erfolgreich ist, ist unfassbar komplex. Da müssen alle Parameter stimmen, und trotzdem laufen die Prozesse in einer Präzision ab, dass es uns so selbstverständlich ist, dass unser Herz schlägt, wir einen Schritt nach dem anderen gehen können, dass Pflanzen wachsen und gedeihen, Fische unter Wasser atmen können usw. Und so dachte ich auf dieser Schottlandreise: Das ist meins, das ist das, was ich in meinem Leben machen will: das Meer und seine Bewohner verstehen. Dass ich selbst aus dem Wissen auch ein Handeln gestalten muss, habe ich im Verlaufe meines Studiums festgestellt. Ich hatte Glück, dass ich beim WWF die Chance dafür bekommen habe, das tun zu können.
«Erderwärmung», «Klimawandel» etc.: verharmlosende, einlullende Begriffe, die Sie am liebsten aus der politischen Kommunikation verbannen würden. Was können wir in diesem Zusammenhang vom «Framing»-Konzept lernen?
Selten bestimmen reine Fakten unser Handeln, Gefühle spielen eine große Rolle. Framing, also wie etwas dargestellt, kommuniziert wird, hat einen Einfluss auf unser Handeln. Gerade in der Politik gibt es viele verharmlosende Begriffe, und ich finde es wichtig, hier treffendere Alternativen zu nutzen. Dass unsere Gefühle unserem klaren Denken gerne falsche Wegweiser hinstellen, muss uns bewusst sein. Selber denken, sich gut, breit und vielfältig zu informieren, ist wichtig, um sich nicht emotional in die Irre führen zu lassen und manipulierte Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber auch nicht, dass allein durch das richtige Framing die Welt gerettet werden kann.
«Wie könnt ihr es wagen?», schleuderte Greta Thunberg den Delegierten der Vereinten Nationen in New York entgegen. Wie gehen Sie als Wissenschaftlerin (und Mutter) mit dem Zorn, der Frustration, der rasenden Ungeduld der Fridays-for-Future-Aktivist:innen um?
Das ist für mich in meiner Arbeit als Umweltschützerin ein riesiger Motivationsschub, dass es jetzt endlich wieder eine junge Umweltbewegung gibt, die ihr Recht auf eine gute Zukunft einfordert. Einigen Menschen macht es Angst, wenn die Kinder auf die Straßen gehen. Sie haben Angst vor der Veränderung, davor, was kommt. Sie wiegeln die Probleme ab, tun Greta Thunberg als «manipuliert» und «vorlaute Göre» ab, zeigen auf die Teenager und werfen ihnen vor, nach der Demo Döner zu essen oder sich mit dem SUV der Eltern abholen zu lassen. Ich wünsche den Fridays-for-Future-Aktivist:innen einen langen Atem. Denn den brauchen sie, um eine derart eingefahrene Politik zu verändern und sich ihre junge Wut, den Verve und die Vehemenz zu bewahren. Meiner Meinung nach dürfen sie sich nicht aufhalten lassen von Argumenten wie: «Ihr habt ja selber keine Idee.» Ich finde nicht, dass sie die parat haben müssen. Wieso sollen Jugendliche mit der richtigen Lösung um die Ecke kommen müssen, wenn 20 Jahre lang die klügsten Köpfe untätig waren?
Frustriert es Sie nicht zu sehen, zu welch gigantischer Kraftanstrengung (auch monetärer Art!) «die Menschheit» bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Lage ist, während der Kampf gegen die letztlich verheerendere Klimakrise im Vergleich dazu quasi auf der Stelle tritt?
Nein, es ist überlebenswichtig, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber was mich frustriert, ist, dass all die Finanzhilfen für die Industrie nicht direkt an ein zukünftig nachhaltigeres und klimaverträgliches Wirtschaften gebunden worden sind. Der Wandel, den die Corona-Krise mit sich bringt, muss auch genutzt werden, um eine Wirtschaft zu gestalten, die im Rahmen unserer planetaren Grenzen handelt.
Katastrophale Verschmutzung der Weltmeere, Überfischung, Artensterben – eigentlich jagt eine Hiobsbotschaft die andere. Und doch beharren Sie auf einer Perspektive der Hoffnung. Weil Sie ein notorisch optimistischer Mensch sind – oder weil der point of no return, was die Zukunft der Meere angeht, tatsächlich noch nicht erreicht ist?
Es gibt immer wieder wissenschaftliche Berichte, die zeigen, dass die Natur große Selbstheilungskräfte besitzt, wenn Mensch sie denn nur in Ruhe lässt. Mit gut konzipierten und verwalteten Meeresschutzgebieten und insbesondere Netzwerken solcher Gebiete können wir die Gesundheit der Ökosysteme fördern und sogar den Abwärtstrend der marinen Artenvielfalt umkehren. Die Forschung zeigt, dass es in gut verwalteten Meeresschutzgebieten mit sogenannten Nullnutzungszonen – also Bereichen, die ganz und gar der Natur überlassen werden – ohne menschliche Eingriffe sehr viel mehr Fische gibt. Sie sind größer, und es gibt eine höhere Artenvielfalt. Aus solchen Schutzgebieten heraus verbessert sich auch der Zustand der angrenzenden Gebiete, sodass auch Fischer davon profitieren.
Am eindrucksvollsten ist für mich das Beispiel des Bikini-Atolls im Westpazifik, das zu trauriger Berühmtheit durch die Atombombentests der USA kam. Die 15-Megatonnen-Wasserstoffbombe, die am 1. März 1954 gezündet wurde, hat damals drei Inseln pulverisiert, einen Krater von zwei Kilometern Durchmesser und 73 Metern Tiefe hinterlassen. Innerhalb von Sekunden entstanden Temperaturen von 55.000 Grad Celsius. Nichts Lebendiges konnte diesem Inferno entgehen. Aber 2017, nach 63 Jahren ohne direkten Einfluss des Menschen, haben Forscher Erstaunliches entdeckt. Statt einer lebensfeindlichen Mondlandschaft fanden sie entgegen allen Erwartungen eine blühende Unterwasserwelt vor. Bis zu acht Meter hohe Korallen mit Armen von bis zu 30 cm Durchmesser, Fischschwärme, Haie, Thunfische und Schnapper – sie alle sind zurückgekehrt. Es gibt also Hoffnung, solange es noch Bereiche im Meer gibt, die noch nicht zerstört sind und wo die Biodiversität erhalten ist. Aber es gibt keinen Grund, sorglos zu sein, denn wir sollten nie vergessen: Eine einmal ausgestorbene Art ist unwiederbringlich verloren. Und die Prognosen, wenn wir unseren Umgang mit der Natur nicht dringend ändern, sind sehr schlecht.
Haben Sie – als Meeresbiologin und begeisterte Taucherin – bei Boris Herrmanns Vendée-Globe-Abenteuer mitgefiebert, dessen Seaexplorer ja Hightech-Regattaboot und Forschungsschiff in einem ist?
Ein eindrucksvoller Mann mit Engagement und ein toller Botschafter für gesunde Meere. Leider habe ich die Regatta aber nicht intensiv mitverfolgt, bis zu dem Punkt, wo die Seaexplorer mit dem Fischerboot zusammengestoßen ist. Seither gibt es Diskussionen darum, ob der Fischer evtl. illegal gefischt haben könnte, weil sein Satelliten-Ortungssystem nicht ordnungsgemäß in Betrieb war.