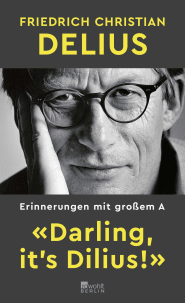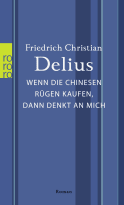F. C. Delius’ Erinnerungen mit großem A
«Kein menschliches Leben ist plausibel. Es verläuft nicht linear, die Linien sind krumm …»

Der Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius, verstorben im vergangenen Frühjahr, wäre im Februar 2023 achtzig Jahre alt geworden. Bis zuletzt schrieb er und näherte sich seinem Leben in einer Autobiographie, wie man sie noch nicht kennt: in gut dreihundert Stichworten, die alle mit A beginnen, spielerisch, gedankenscharf und poetisch. Von «Abbey Road» und «Abendrot» über «Adorf» und «Adorno», «Akte» der Stasi und «Aktien» von Siemens, acht «Altkanzler», «Abstand», «Anstand», «Aufstand» bis zu «Arroganz» und «Azzurro» schildert Delius in konzentrierten Texten, was (und wer) ihm aus all den bewegten und begegnungsreichen Jahrzehnten wirklich wichtig ist. Eine persönliche Chronik, in der man durch die Augen eines bedeutenden Autors auf die Welt blickt; hier wird das Erinnern selbst zur Kunst.
Seine Lebenserinnerungen unter einem Buchstaben, dem ersten des Alphabets, zu subsumieren, ist eine hinreißende Idee für eine Autobiographie. Der im Kleinen wie im Großen lauernden Gefahren autobiographischer Prosa war sich Delius immer bewusst: «Fast alle Autobiographien kranken an ihrer inneren Zielgewissheit, selbst wenn sie Umwege, Abgründe, Irrtümer fleißig benennen. Die Vorstellung, dass sich ein Leben rundet, dass mehr oder weniger rote Fäden die Strecke langer Jahre markieren, dass sich Kreise schließen, Nebenpfade und Abstürze als segensreich erweisen, ist zu naheliegend, um die Selbstbiographen nicht zu verführen, ihrem Leben möglichst viel Sinn, Plausibilität, Allgemeinbedeutung und Zielwasser zuzuschreiben.» Schriftsteller verfügten über Möglichkeiten, «Erinnerungspartikel so zu formen und in sprachliche Kunstwerke zu verwandeln, dass das Autobiographische nicht mehr im Vordergrund steht».
Für «Darling, it’s Dilius!» hat er sich zwar von George Perecs Roman «Das Leben. Gebrauchsanweisung» inspirieren lassen, einem Wunderwerk fragmentarischen Erzählens, aber Friedrich Christian Delius geht hier einen ganz anderen, eigenen Weg der Ordnung seiner Erinnerungen. Mit dem Mut zur Lücke und der Selbstermahnung «Nimm dich nicht so wichtig, Junge!» schenkt der Büchner-Preisträger uns, seinen Leserinnen und Lesern, zum Abschied ein Buch der Erinnerungen rund um das große A – widerborstig, hellsichtig und oft ungemein amüsant. Hier eine kleine Auswahl:
A wie Achternbusch, Abendland, Adenauer oder …
A4-Papier. Hunderttausend Blatt besten DIN-A4-Papiers, achtzig Gramm, weiß, die große Palette einer Papierfabrik stand 1987 eines Tages vor der Haustür. Ein Geschenk, das Honorar für ein paar Zeilen zum Thema Papier. Leonie Ossowski, die Schriftstellerin, mit der ich von 1986 bis 2003 im Kuratorium des Literaturhauses Berlin arbeitete, hatte mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Text für den Kalender einer Papierfabrik schreiben wolle, sie dürfe vier oder fünf Autoren aussuchen, das Honorar bestehe aus hunderttausend Blatt Papier. Viel zu viel, dachte ich, als ich die Palette sah. Das reicht fürs Leben, eine irritierende Vorstellung. Mit Mühe passten die zwanzig schweren Kartons mit je zehn Packen à fünfhundert Blatt in den Keller. Anfangs verschenkte ich einige Packen an Freunde und die nähere und weitere Familie, aber achtzig Prozent etwa verbrauchte ich selbst, vorwiegend als Druckerpapier. Es folgten die Jahre der drei Erzählungen «Die Birnen von Ribbeck», «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde» und «Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus», in denen ich viel ausdruckte. Dann Umzüge, nach Rom zum Beispiel musste man kein Papier tragen. So waren erst 2018 die letzten Blätter dran.
Aber. Keine andere Konjunktion, schätze ich, taucht so oft in meinen Rohtexten und Manuskripten auf und wird so oft gestrichen in den folgenden Fassungen wie der Gegensatz- und Widerspruchsausdruck Aber. Aber es bleiben noch genügend übrig.
Abish, Cecile und Walter. «Darling, it’s Dilius!», hörte ich Cecile Abish in den Raum rufen, laut und fröhlich. Ich wartete am Telefon in New York, um mit Walter Abish und seiner Frau einen Besuch zu verabreden, beide hatten mich in Berlin ermuntert, bei der nächsten Reise in die USA bei ihnen aufzutauchen. Nun lauschte ich der Melodie dieser Silben hinterher, dem Wohlklang des ungewöhnlichen, nur beim Komponisten Frederick Delius gewohnten I am Anfang meines Namens, dem heiteren, rhythmischen Stabreim: Darling, it’s Dilius! Fast alle Amerikaner und Briten sprachen meinen Nachnamen so aus, aber so fröhlich und melodisch wie von Ceciles starker Stimme hatte ich ihn noch nicht gehört.
Abstand. Schlüsselwort der Zeiten der Coronapandemie 2020 ff. und Schlüsselwort des Gedichts «Selbstporträt mit Luftbrücke» von 1993, in dem es heißt:
Zu neunundneunzig Prozent ein Schimpanse
streif ich durchs Gelände des restlichen Prozents,
durchs Gehölz der Gene vorwärts wohin und
immer den Schritt weiter, der dann zu weit geht:
Abstand!
Ahab. Einige der arrogantesten und romantischsten Köpfe meiner Generation schlossen sich in den siebziger Jahren in der RAF, der «Roten Armee Fraktion», zusammen, um mit ein paar Pistolen und Schnellfeuergewehren eine Revolution herbeizuschießen. Terrorismus, Deutscher Herbst 1977, viele Tote, das ist bekannt. Eine aus diesem Kreis, Gudrun Ensslin, hatte ich Jahre zuvor flüchtig kennengelernt, wir hatten 1965 mit anderen Autoren im «Wahlkontor deutscher Schriftsteller» für die SPD Werbesprüche geschrieben, sie war mit Bernward Vesper Verlegerin geworden. Ihr romantisches Talent krönte sie damit, rund zehn Jahre später im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim ihren Genossen Namen und Charaktere aus Melvilles «Moby Dick» zuzuteilen. So wurde Andreas Baader am Ende noch als Kapitän Ahab geadelt, was den Wahn oder den wahnhaften Humor der Gruppe verdeutlicht und was sich der Autor von «Himmelfahrt eines Staatsfeindes» nicht entgehen lassen konnte ...
A wie Adorno, Alleinsein, Auschwitz oder …
Achtundsechzig. Ein Rückblick von Achtundneunzig: Von 1968 habe ich, offen gesagt, die Schnauze voll. Nicht von den alten Erfahrungen, die auch meine Studentenjahre gewürzt haben und nun ein halbes Leben zurückliegen. Was das Thema Achtundsechzig so degoutant macht, ist seine mediale Zubereitung Jahrzehnte später. (…) Die Bilder, Berichte und Dokumente aus alten Zeiten lügen nicht, aber sie lügen doch. Sie zeigen die Leute aus den ersten Reihen, die wildesten Gesichter, die nacktesten Kommunarden, die plakativsten Plakate, die unordentlichsten Wohnungen, die rotesten Fahnen, die spektakulärsten Aktionen. Zitiert werden die kämpferischsten Reden, das auffälligste Polit-Kauderwelsch, die euphorischen – und nicht die skeptischen Stimmen. (…) Keine politische Bewegung ist so auf ihre eigenen Mythen und Klischees hereingefallen wie die Achtundsechziger. Die meisten dieser Klischees sind sogar nicht einmal falsch. Trotzdem sage ich: Alles war anders, nämlich viel widersprüchlicher, mehrdeutiger, spielerischer.
Altachtundsechziger. Ich will ja nicht wissen, wie andere, die nicht wissen, dass ich kein Altachtundsechziger bin, sondern ein Altsechsundsechziger, über mich als Altachtundsechziger herziehen, aber eine Bemerkung dazu ist mir auch erlaubt, eine Notiz aus dem Jahr 1993: Warum sehen gerade die Altachtundsechziger so uralt aus, zum Beispiel gestern Fritz Teufel wie sein eigener Urgroßvater, so abgrundmüde, mit abgestandenem Witz? Eine der wenigen Ausnahmen: Daniel Cohn-Bendit hat die flinken, feurigen Augen und den Esprit behalten.
Angst. Salman Rushdie, 1992 nach Ajatollah Khomeinis Fatwa zum ersten Mal in Deutschland, höchst konspirativ, Gespräche in Bonn, für den Abend lädt der PEN zum Essen, erst ein Hotel in Bad Godesberg, dann eins im Norden, schließlich ein Hotel in Königswinter, sechs Leibwächter am Nebentisch. «Ich habe beschlossen, keine Angst mehr zu haben, mein Leben zu leben, soweit das geht», sagt er und möchte endlich wieder als Literat wahrgenommen werden. Ich bewundere seine flotten Sneakers, «to improve my running away». Am liebsten hätten wir, statt mit der Vorspeise zu beginnen, erst mal eine Runde Tischtennis gespielt.
Arbeitsmotto. «Leser kann man nicht genug betrügen», dieser fröhliche Satz von Jean Paul ist mir im dritten Semester zugeflogen, bei der Lektüre seines Romans «Hesperus». Obwohl ich damals erst ein paar pointensüchtige Gedichte geschrieben hatte und an Romane und anderes noch lange nicht zu denken war, kam mir der Satz wie ein Motto vor, ein Arbeitsmotto für mutige formbewusste und selbstbewusste Schriftsteller.
Arendt, Hannah. Von allen Gedanken und klugen Sätzen dieser außerordentlichen Lehrerin hat mir ihre Bemerkung, die sie bei einer Deutschlandreise 1950 notierte, am besten geholfen, meine Landsleute zu begreifen: «Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt jedoch in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen.» Von allen Anekdoten, die Lotte Köhler, die amerikanische Mecklenburgerin und Nachlassverwalterin Arendts, über ihre langjährige Freundin erzählte, ist diese vielleicht die beste: Hannah konnte sehr konservativ sein, sagte Frau Köhler. Es war ihr sehr peinlich, dass Uwe Johnson, der längere Zeit bei ihr wohnte, so viel Rotwein soff, sie meinte, dass die Leute vom Liquor Store das auch auf sie schieben würden. Nach einem alkoholbedingten Streit mit Johnson wollte der sofort ausziehen, es war schon Mitternacht, er packte seine Koffer, da herrschte Arendt ihn an: Wer bei mir wohnt, zieht mitternachts nicht aus!
Autobiographisches Erzählen. Ohne schonungslose Erinnerung geht nichts. Aber man muss auch wissen, dass jede noch so redliche Erinnerung schummeln kann, ohne dass wir das von ihr fordern. Das Erlebte wird nicht nur verschönert, vergrößert, idealisiert. Unser Gehirn hat bekanntlich die wunderbare und gefährliche Eigenschaft, gelesene oder in Filmen gesehene Szenen, Träume und Phantasien nahtlos mit dem wirklich Erlebten zu verbinden und uns ungewollt zu Schwindlern zu machen. Hier braucht es Instinkt. So ist «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde» mein erster autobiographischer Text geworden. Nicht nur ein Buch über meine kindlichen Nöte, auch über die Macht von Sprache, Religion und die christliche Erziehung, das Dorfleben der fünfziger Jahre, Radiohören und die Fan-Werdung, die kindliche Identifizierung mit (Fußball-)Helden.