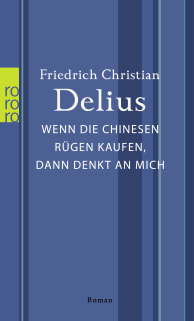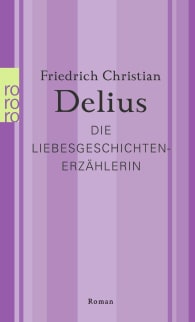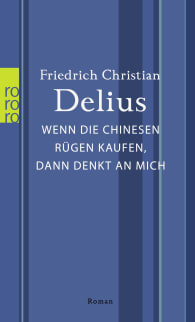In Zeiten der Verunsicherung verschiebt sich mitunter der Blickwinkel auf unsere Welt – und bei einigen von uns auch wortwörtlich. Viele arbeiten in diesen Tagen mobil, in ihren eigenen vier Wänden und mit neuer Aussicht. Und vielen fällt es schwer, mit dieser Situation umzugehen. Drinnen zu bleiben und nicht zu wissen, was noch auf uns zukommt.
Wie viele andere machen wir Rowohltianer uns Sorgen - um unsere Familien, Freunde und Bekannte und um unsere Autor*innen. Einige unserer Autor*innen haben wir gefragt, wie sie mit der Pandemie leben. Was sie gerade beschäftigt. Einige der Texte, die uns erreicht haben, sind humorvoll, viele machen nachdenklich und ein paar auch traurig, die meisten geben uns aber Hoffnung. Hoffnung, dass wir diese Krise gemeinsam irgendwie überstehen werden.
«Viele schreiben jetzt eifrig Tagebuch, viele filmen, sprechen, streamen jetzt ihr Tagebuch. Ich denke an meine Urgroßmutter, die, wie sehr viele Menschen damals, am ersten Tag des Ersten Weltkriegs ein Tagebuch zu schreiben begann, sehr gewissenhaft, sehr ausführlich, sehr verbohrt aus heutiger Sicht, und bis Anfang 1919 durchhielt, die Generalleutnantsgattin (ihr General überlebte, ihr Sohn nicht). Nein, ich werde kein Tagebuch schreiben. Nur ein paar Notizen aus der Intensivstation.
Eine Arbeitspause, ich schaue in die Ferne auf die oberen Hochhäuser der Berliner City West, bin aufgestanden von meiner Intensivstation am Schreibtisch. Das hört sich kokett an, wenn ich das hier so hinschreibe oder in Gesprächen so nenne, aber für drei, vier Stunden am Vormittag stimmt das. Im Dezember, als Corona nichts als eine blasse Biermarke war, hatte ich entschieden, etwa ab März einen Erzähltext über meine drei Wochen auf der Intensivstation im Jahr 2008 zu beginnen. Die Erfahrung mit dem erzwungenen Schweigen durch den Ausfall der Stimme, des Bewusstseins, die Albträume des stimmlosen, verständnislosen, endlosen Erwachens aus langem Koma.
Damals hatte ein unbekannter Virus oder eine teuflische Virus-Bakterien-Kombination, wahrscheinlich im Flugzeug eingefangen, mir eine schwere Lungenentzündung verpasst, sodass man mich im letzten Moment ins Koma schickte, aus dem ich, überdies durch einen Arztfehler fast umgebracht, nach zweieinhalb Wochen qualvoll und traumvoll erwachte. Es wurde als Wunder betrachtet, dass ich allmählich wieder unter die Lebenden kam und mich relativ schnell erholte. Die Endlosträume auf der Intensivstation, von den Medizinern Delir genannt, konnte ich noch drei, vier Wochen danach bis ins Detail erinnern und notieren.
Nein, es ist nicht lustig auf der Intensivstation, auch nicht auf meiner von 2008, auch nicht die sprachliche Annäherung. Aber jetzt, da ein anderes Virus die Welt erobert, will ich nicht kneifen. Vielleicht gelingt es ja, anderen etwas von diesen Erfahrungen mitzuteilen. Nun bin ich bereits mittendrin, wo doch eigentlich Abstand halten auch eine literarische Devise ist. Es ist nicht leicht herauszufinden, ob ich das Gleiten ins wortlose, bildreiche Nichts und diese Träume und die Erfahrung der Stimmlosigkeit sprachlich zu fassen kriege. Gerade bin ich auf Seite 16 angekommen. Kleine Pause, ein bisschen Gymnastik wäre fällig.
Wegen der diversen Erkrankungen und des Alters gehöre ich nicht zur Risikogruppe, sondern zur Hochrisikogruppe. Das schärft, hoffe ich, den Blick (und das ist nur einer der schönen Vorteile des Alters). Das Aufblättern der zwölf Jahre alten Erfahrungen wird nicht ganz umsonst sein, möchte ich mir einbilden, vielleicht stärkt es ja das Immunsystem.
Eins ist sicher, das wird ein Epochenbruch, denke ich, wenn ich hinübersehe in die Ferne zu den Spitzen der Hochhäuser der City West, zu den hell strahlenden Geschwistertürmen am Bahnhof Zoo. In einem, dem eckigen, viele Büroetagen und das Hotel Waldorf Astoria, im andern, dem runden, viele Büroetagen und das Hotel Motel One. Beide, die Luxusklasse und die Holzklasse, voll mit leeren Schreibtischen und mit leeren Betten. Stolze Fassaden und innen wahrscheinlich ziemlich menschenleer.
Es gab eine Zeit, da fürchtete man die Neutronenbombe, jetzt sind es die Explosionen eines Virus, die für gesellschaftliche und wirtschaftliche Implosionen sorgen. Nicht nur der Flachsinn des extensiven Reisens und der Vielfliegerei wird nachlassen, auch der Stumpfsinn der Hotelkapazitätenwachstumspolitik wird schrumpfen. Aber ich mag solche Gedanken nicht, mag nicht mitspielen bei dem bald inflationären Wettstreit der Soziologen und der Vielschreiber, sich die Welt von übermorgen schon heute auszumalen. Bei den Sandkastenspielen, ob der Neoliberalismus demnächst schwindet oder doch triumphiert. Das ist schon deshalb unappetitlich, weil noch gar nicht auszudenken ist, wie die armen Länder, wie die Afrikaner, die Inder, die Lateinamerikaner durch diese Katastrophe kommen werden. Im Übrigen halte ich mich an die Details und bin mit dem Staunen über die menschenleeren Geschwistertürme noch nicht fertig, denen man so gar nichts Schlimmes ansieht. Und doch sind sie ein besserer Anblick als die in Staub gestürzten Zwillingstürme vor achtzehneinhalb Jahren.
Epochenbruch ist ein großes, angeberisch tönendes Wort, aber ich weiß noch kein treffenderes für die Augenblicke dieser Tage, in denen, buchstäblich von heute auf morgen, die menschliche Existenz einmal wieder existenziell betrachtet werden muss und wird. Eine Zeit, in der die Toten gezählt werden. Eine Zeit, in der die Sterbenden allein sterben. In Mitteleuropa zum ersten Mal wieder seit dem Zweiten Weltkrieg, nach ungewöhnlich friedlichen und sorgenschwachen fünfundsiebzig Jahren steht nach zwei, drei Generationen diese Erfahrung wieder vor der Tür: Jederzeit kann es jeden treffen. Die eine Gruppe mehr, die andere weniger, wie in jedem Krieg und wie bei jeder Pest.
Das Virus diktiert uns ein Wir, überlege ich beim Blick auf die Türme der City. Das neue Virus ist gnädiger als die alten Kriege, es trifft eher die Alten als die Jungen. Die Gesellschaften werden sich, auch das scheint sicher, verjüngen. Doch auch wir Älteren haben es besser, zumindest in unseren Breiten. Anders als unsere Vorfahren können wir uns rund um die Uhr informieren und mit den Nächsten austauschen, haben Telefon und Internet, Lieferketten und verantwortungsvolle Regierungen, Aufklärung und Ablenkung, Post und Mail, Skype, Video und Facetime, Facebook und haltbare Bücher. Und, ganz wichtig, wir sind nicht dazu verdonnert, uns militärisch verbiegen zu lassen und unsere Nachbarländer als Feinde zu hassen und zu vernichten. Im Gegenteil, der Sinn für Nachbarschaft und Gemeinsinn wächst.
Ich gehe wieder an den Schreibtisch, muss die Seiten 15 und 16 noch einmal Wort für Wort durchgehen. Lieber wäre ich jetzt in Stralsund oder Sassnitz, wo ich in diesen Tagen aus meinem Roman «Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich» hätte lesen sollen, nah an einem der Orte der Handlung, den Kreidefelsen am Königsstuhl. Der Protagonist des Buches fragt sich hin und wieder, ob wir schon oder demnächst in der «prächinesischen Epoche» leben. Das Virus hat diese Frage frivol gemacht. Und für ein paar Wochen vertagt. Aber nun ist zu lesen, dass China für Italien und andere Länder die letzte Hoffnung beim Kampf gegen das Virus zu werden beginnt. Vorsicht, Abstand halten, es ist zu viel bittere Ironie in der klaren Frühlingsluft!»
Süddeutsche Zeitung, 27.3.2020